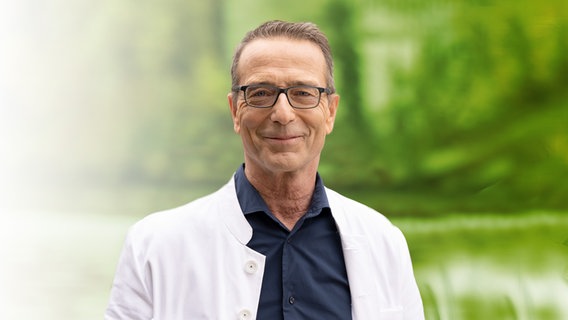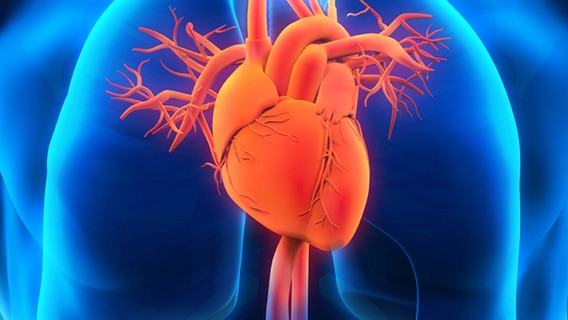Parodontitis: Symptome, Behandlung und Ursachen
Eine Zahnbettentzündung (Parodontitis) kann zu Zahnverlust und Entzündungen führen und erhöht das Risiko für Herz- und Diabeteserkrankungen. Parodontose hingegen verläuft ohne Entzündung.
In Deutschland sind laut Bundeszahnärztekammer rund 35 Millionen Menschen an einer mehr oder weniger ausgeprägten Zahnbettentzündung erkrankt. Der Fachbegriff für die Volkskrankheit ist Parodontitis, umgangssprachlich wird die Erkrankung auch Parodontose genannt. Genau genommen ist das nicht dasselbe, da es bei der Parodontose zwar einen Zahnfleischrückgang, aber keine akute Entzündung gibt. Im Gegensatz zur Parodontitis ist die Gingivitis eine mildere Form, bei der das Zahnfleisch nur oberflächlich entzündet ist.
Was sind typische Symptome einer Parodontitis?
Wenn sich Bakterien aus Speichel und Nahrungsresten in Richtung Zahnfleischrand und Zahnwurzeloberfläche vorarbeiten, äußert sich das mit unterschiedlichen Beschwerden. Da eine Parodontitis im Frühstadium nicht wehtut, bleibt sie ohne den jährlichen Check beim Zahnarzt leicht unentdeckt. Zu den häufigsten Symptomen der Zahnbettentzündung zählen:
- gerötetes und geschwollenes Zahnfleisch (Zahnfleischentzündung)
- Zahnfleischbluten
- entzündete Zahnfleischtaschen
- Mundgeruch
- Rückzug des entzündeten Zahnfleisches
- Zahnhälse werden immer sichtbarer
- lockere Zähne
Ursachen: So entsteht Parodontitis
Zunächst bildet sich durch schlechte Mundhygiene Zahnbelag. Mineralisiert dieser Belag, entsteht Zahnstein - die ideale Oberfläche für die Ansiedlung von Bakterien. Diese vermehren sich durch Stoffe, die sie im Speichel und Nahrungsresten finden. Vor allem Zucker kurbelt die Vermehrung an. Die Bakterien bilden einen Biofilm (Zahnbelag), der sich vom Zahnfleischrand entlang der Zahnwurzeloberfläche ausbreitet. Die Bakterien scheiden Säuren und Gifte ab, die eine fortschreitende Zahnfleischentzündung auslösen können - bis hin zur Entzündung des gesamten Zahnbettes mit einem im Röntgenbild sichtbaren Knochenabbau um den Zahn. Bei einer Parodontitis bilden sich tiefe Taschen am Zahnfleischrand, in denen Nahrungsreste hängen bleiben. Bakterien können sich in den Zahnfleischtaschen optimal vermehren.
Inzwischen ist bekannt, dass es auch eine genetische Vorbelastung, also eine erbliche Veranlagung für Parodontitis gibt, die bis zu 50 Prozent des Risikos ausmacht. Insbesondere bei jüngeren Betroffenen ist davon auszugehen, dass die erbliche Veranlagung bei ihnen eine Rolle spielt.
Risikofaktoren für eine Parodontitis
Das kann die Entstehung einer Parodontitis begünstigen:
- schlechte Zahnpflege
- Zahnstein
- falsche Ernährung
- Rauchen
- Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes
Bakterien verteilen sich im Körper
Eine Parodontitis gefährdet nicht nur Zahnfleisch und Zähne. Sie gilt auch als Risikofaktor für Herzerkrankungen, Schlaganfall, Gefäßverschlüsse, Alzheimer, Parkinson, Rheuma und Diabetes:
- Eine Parodontitis beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit und führt zu erhöhten Entzündungswerten im Blut.
- Durch die chronische Entzündung schwindet der Knochen und das Zahnfleisch zieht sich zurück, sodass die empfindlichen Zahnhälse frei liegen und Zähne wackeln.
- Bakterien können in die Blutbahn gelangen, Entzündungsstoffe im Körper verteilen und dadurch Schäden an Organen und Gewebe verursachen. Sie können auch den Übertritt von Zuckermolekülen aus der Blutbahn in die Zellen behindern und so den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen.
- Auch der Blutdruck kann infolge einer Parodontitis ansteigen.
Zahnseide und Wurzelbehandlung senken Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall
Eine Parodontitis kann für das Herz sehr gefährlich werden: Die Bakterien in den Zahnfleischtaschen aktivieren das Immunsystem, was zu einer dauerhaften Entzündungsreaktion in den Blutgefäßen führt. Die Gefäßinnenwände werden dadurch geschädigt, werden rauer und durchlässiger. Das begünstigt die Ablagerung von Cholesterin und anderen Fetten, die sich in den Arterien absetzen. Durch die Ablagerungen entstehen sogenannte Plaques, die die Arterien verengen (Arteriosklerose). Diese Plaques können reißen und ein Blutgerinnsel verursachen. Löst sich das Blutgerinnsel, kann es ein Gefäß im Herzen blockieren, was zum Herzinfarkt führt. Blockiert es ein Gefäß im Gehirn, kann das zum Schlaganfall führen. Menschen mit bereits geschädigten Gefäßen reagieren besonders empfindlich auf entzündliche Prozesse im Körper, sodass Bakterien aus dem Mund das Fortschreiten einer Arteriosklerose beschleunigen können.
Eine Studie zeigt nun, dass Flossing, also das Verwenden von Zahnseide (englisch: floss), das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken kann. Dazu sollten mindestens ein Mal wöchentlich, besser täglich, die Zahnzwischenräume gründlich mit Zahnseide und Zwischenraum-Bürstchen passender Größe gereinigt werden. Dazu circa 40 bis 50 Zentimeter Zahnseide abschneiden - etwa die Länge eines Unterarms. Die Zahnseide um die Mittelfinger beider Hände wickeln, sodass circa drei bis fünf Zentimeter zwischen Daumen und Zeigefinger gespannt sind. Gleitend zwischen die Zähne bewegen, ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Zahnseide um den Zahn herumlegen, sodass sie eine C-Form bildet. Bis leicht unter den Zahnfleischrand schieben, um Plaque in der Tasche zu entfernen. Für jeden Zahnabschnitt ein sauberes Stück Zahnseide verwenden. Mit den Bürstchen vorsichtig die Zwischenräume der Zähne reinigen. Anschließend nachspülen, um gelöste Beläge zu entfernen.
Aber auch eine Entzündung in den Zahnwurzeln, die sogenannte apikale Parodontitis, kann gefährlich werden: Betroffene haben ein bis zu fünfmal höheres Risiko, eine koronare Herzerkrankung zu entwickeln oder Schlaganfälle zu bekommen. Studien zeigen, dass eine erfolgreich durchgeführte Wurzelkanalbehandlung das Risiko für Koronare Herzerkrankungen um bis zu 84 Prozent senken kann. Bei einer Wurzelkanalbehandlung wird die Zahnkrone mit einem Bohrer geöffnet und das Zahnmark mit feinsten Instrumenten entfernt. Die leeren Wurzelkanäle werden gereinigt und desinfiziert, um die Bakterien abzutöten. Die sauberen Kanäle werden anschließend mit einem flexiblen Material gefüllt und die Krone mit einer Zahnfüllung verschlossen. Oft ist eine künstliche Krone nötig, um den behandelten Zahn zu schützen und die Gebissfunktion wiederherzustellen.
Diagnose der Parodontitis
Die Zahnärztin oder der Zahnarzt kann ohne großen Aufwand bei der Routineuntersuchung den Grad einer möglichen Zahnbettentzündung ermitteln. Mit einer Spezialsonde wird vorsichtig die Tiefe der einzelnen Zahnfleischtaschen ausgemessen und die Blutungsneigung bestimmt. Die Ergebnisse werden im Parodontalen Screening-Index (PSI) zusammengefasst und eingestuft: Bei PSI 1 und 2 liegt die Taschentiefe unter 3,5 Millimeter, bei PSI 2 kommen aber Zahnstein oder Beläge dazu, die gefährlich werden können. Bei einem PSI 3 besteht der Verdacht auf eine leichte bis mittelschwere Parodontitis, die Taschentiefen liegen zwischen 3,5 und 5,5 Millimeter. PSI 4 bedeutet eine mittelschwere bis schwere Parodontitis mit Taschentiefen über 5,5 Millimeter.
Antientzündliche, zuckerarme Kost gegen Parodontitis
Zur Ursachenbekämpfung bei Parodontitis gehört neben besserer Mundhygiene auch die Umstellung auf eine ausgewogene, antientzündliche Ernährung. Besteht bereits ein Diabetes, ist auf eine gute Einstellung des Blutzuckers zu achten. Hier hilft die Orientierung am Logi-Prinzip: Kohlenhydrate sind deutlich zu reduzieren, insbesondere Zucker - auch versteckter Zucker in industriell hergestellten Lebensmitteln - und helles Mehl.
Die richtige Ernährung beugt Parodontitis vor und ist Voraussetzung dafür, dass eine Zahnbettentzündung dauerhaft ausheilen kann. Ganz geheilt werden kann eine Parodontitis nur in sehr seltenen Fällen, aber durch geeignete Maßnahmen lässt sich ihr Wiederauftreten oft vermeiden.
Parodontitis-Behandlung: Zahnreinigung und chirurgische Eingriffe
Erst wenn die hartnäckigen Beläge beseitigt sind, hat das Zahnfleisch eine Chance abzuheilen. Um die Erkrankung zu bekämpfen, werden die Zahnbeläge (Plaques) bei einer professionellen Zahnreinigung (PZR) mechanisch entfernt.
Zahnfleischtaschen mit einer Tiefe von mehr als sieben Millimetern müssen chirurgisch gereinigt werden, weil die Zahnpflegeinstrumente nicht alle betroffenen Stellen erreichen. Dabei wird das Zahnfleisch unter örtlicher Betäubung heruntergeklappt, um die Plaques und Ablagerungen darunter zu entfernen. Danach wird das Zahnfleisch wieder genäht. Anschließend erhält der Patient für einige Tage hochdosierte Antibiotika, um die Entzündung zu bekämpfen. Nach der Behandlung zieht sich das Zahnfleisch zusammen und legt sich an die Zähne an.
Kosten der Parodontitis-Behandlung
Seit Mitte 2021 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die Behandlung und die Nachsorge einer diagnostizierten Parodontitis. Die spezielle Früherkennungsuntersuchung auf Parodontitis, der Parodontale Screening Index (PSI), wird alle zwei Jahre von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.
Plasmatherapie gegen Parodontitis
In einigen Fällen kann eine Therapie mit kaltem Plasma eine Operation überflüssig machen. Kaltes Plasma ist Umgebungsluft, die mit Sauerstoff angereichert wird. Bei einer Plasmabehandlung wird zunächst der Zahnstein unter dem Zahnfleisch per Ultraschall entfernt. Im Anschluss setzt der Zahnarzt eine weiche Bissschiene ein, die über einen Schlauch mit dem Plasmagerät verbunden ist. Während der zehnminütigen Sitzung umflutet kaltes Plasma alle Zahnfleischflächen. Dabei zerstört es die Zellmembranen der Bakterien, deaktiviert Viren und reinigt die Wundflächen. Es soll auch die tiefen Zahnfleischtaschen erreichen. Pro Zahn kostet eine Plasmatherapie etwa 10 bis 15 Euro - die gesetzlichen Krankenkassen zahlen die Behandlung nicht.
Parodontitis vorbeugen: Schwarzkümmelöl und Co.
- Zahnzwischenräume reinigen: Die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume ist wichtig - am besten entweder morgens oder abends. Dazu Zahnseide oder für jeden Zahnzwischenraum die passende Interdentalbürste verwenden. Zwischen eng stehenden Zähnen ist Zahnseide eine gute Wahl. Bei größeren Zahnzwischenräumen, aber auch bei Brücken oder Zahnspangen sind Interdentalbürsten besser geeignet. Bei der Auswahl der passenden Bürsten und bei Fragen zur richtigen Anwendung hilft das zahnärztliche Prophylaxe-Personal.
- Interdentalbürsten richtig anwenden: Interdentalbürsten immer vollständig durch den Zwischenraum schieben, aber nicht mit Gewalt. In jedem Zahnzwischenraum die Bürste fünfmal hin- und herbewegen und immer wieder unter fließendem Wasser reinigen. Zum Schluss noch einmal gründlich abwaschen und zum Trocknen aufstellen. Interdentalbürsten müssen regelmäßig gewechselt werden.
- Ölziehen schwemmt Bakterien aus: Dazu ein bis zwei Teelöffel Schwarzkümmelöl auf das Zahnfleisch geben und einreiben. Einige Minuten einwirken lassen und dann den Rest ausspucken. Das Schwarzkümmelöl eignet sich auch für das Ölziehen. Bei diesem ayurvedischen Naturheilverfahren wird das Öl durch den Mund und die Zahnzwischenräume bewegt. Schwarzkümmel enthält leicht antibakteriell wirkende ätherische Öle.
- Grünen Tee trinken: Wer regelmäßig grünen Tee trinkt, stärkt sein Zahnfleisch und kann laut einer japanischen Studie auch einer Parodontitis vorbeugen.
- Rauchen aufgeben: Raucher haben neben vielen anderen Risiken auch ein sechsmal höheres Risiko, an Parodontitis zu erkranken.
- Zahnreinigung: Zahnärzte empfehlen, zweimal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen. Ihre Kosten werden nicht von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. Aber viele Kassen gewähren einen Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung. Die gründlich entfernten Belege können sich schnell neu bilden, doch die gleichzeitige Schulung und Kontrolle des Putzergebnisses kann ein nachhaltiger Impuls für die bessere tägliche Pflege sein.
- Kontrolluntersuchung: Sinnvoll ist auch eine Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt alle sechs Monate.
Expertinnen und Experten aus dem Beitrag
Weitere Informationen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Zahnmedizin