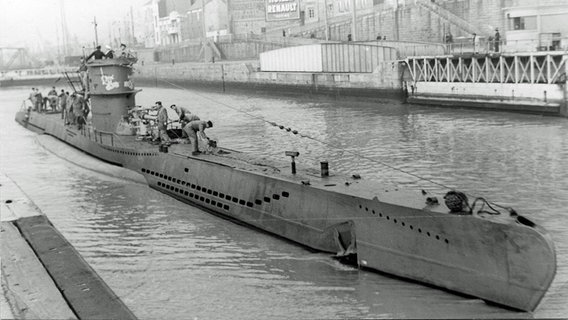Christa Wolf: Eine Autorin zwischen Verehrung und Verachtung
Vor der Wende feierte man sie als gesamtdeutsche Autorin. Später wurde Christa Wolf teilweise als "DDR-Staatsschriftstellerin" geschmäht. Am 1. Dezember 2011 starb sie im Alter von 82 Jahren in Berlin.
"Dass die Zeit uns verkennen muss, ist ein Gesetz" - der Satz aus Christa Wolfs "Kein Ort. Nirgends." (1977) kennzeichnet auch ihre eigene Karriere als Schriftstellerin. Spätestens seit dem internationalen Erfolg ihres Romans "Kassandra" (1983) als gesamtdeutsche Schriftstellerin gefeiert, wurde Wolf nach der Wende vom westdeutschen Feuilleton nur noch auf ihre Nähe zum DDR-Regime reduziert.
Die deutsche Teilung ist aus dem Werk der Schriftstellerin, die zuletzt in Berlin und Mecklenburg wohnte, nicht wegzudenken, ihr politisches Engagement hat die Reaktionen auf Person und Werk bestimmt. Sowenig sich jedoch ihre Nähe zu und ihre Konflikte mit dem DDR-Regime auf einen einfachen Nenner bringen lassen, lässt sich Wolfs Literatur auf die politischen Aspekte reduzieren.
Der geteilte Himmel

Nach ihrem Studium der Germanistik und der Arbeit als Lektorin veröffentlicht die 1929 im heute polnischen Landsberg/Warthe geborene Wolf 1961 zunächst nur in der DDR ihr erstes Prosawerk "Moskauer Novelle". Der im folgenden Jahr erscheinende Roman "Der geteilte Himmel" findet auch im Westen Beachtung.
Wolf, seit 1949 Mitglied der SED und davon überzeugt, der Sozialismus stelle die wünschenswertere Gesellschaftsform dar, setzt sich in dem Werk mit den Folgen der deutschen Teilung auseinander. Es stößt - wie bei dem Thema zu erwarten - bei den Kulturoffiziellen der DDR nicht auf ungeteilte Begeisterung: Zwar erhält Wolf den Heinrich-Mann-Preis der DDR und das Buch wird zwei Jahre später von der DEFA verfilmt, doch werden "große Lücken in der Darstellung der Republik und ihrer Menschen" bemängelt.
Wolfs "subjektive Authentizität"
Nicht nur die Wahl des Themas, auch die literarische Form des Romans gehe nicht wie gewünscht mit der herrschenden Ideologie konform. "Der geteilte Himmel" wird als "zu modern" kritisiert - soll heißen: nicht genügend im Sinne des "Sozialistischen Realismus" gestaltet.
Die nachfolgende Erzählung "Juni-Nachmittage" markiert ihre Wendung zu einem realistischeren Stil, den sie selbst als "subjektive Authentizität" bezeichnet und der fortan charakteristisch für ihr Werk ist. Dass Wolf im Gegensatz zur von der offiziellen Doktrin geforderten Objektivität auf das subjektive Moment in der Literatur setzt, bringt sie immer wieder in Konflikte mit der Obrigkeit - Konflikte, die Wolf bei aller Nähe zum Regime nicht scheut.
Im Visier der Stasi
Parallel zu den künstlerischen Differenzen mit der Staatsführung, der Wolf fast selber angehört hätte, entwickeln sich politische. Wolf, die nach eigener Aussage seit Beginn der 60er-Jahre zunehmend davon enttäuscht ist, wie der "real existierende Sozialismus" ihre utopische Vorstellung einer gerechten Gesellschaft ersetzt, verliert 1967 nach einer kritischen Rede vor dem Zentralkomitee der SED ihren Status als Kandidatin für das höchste Parteigremium.
Als das Ehepaar Christa und Gerhard Wolf 1976 gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann protestiert, wird sie aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen, ihr Mann auch aus der Partei. Das schon länger im Visier der Staatssicherheit stehende Ehepaar wird daraufhin über Monate auch ganz offen ausgespäht.
Kein Land. Nirgends
In der Folge erwägt Christa Wolf, die inzwischen in Berlin und Mecklenburg wohnt, die DDR zu verlassen, entscheidet sich aber dagegen: Im kapitalistischen Westen sieht sie keine Alternative zum Sozialismus. Trotz ihres Engagements für Biermann bedient sich auch die Staatsführung weiterhin der Schriftstellerin als Aushängeschild sozialistischen Kulturfortschritts und privilegiert Wolf: Sie ist Mitglied der Akademie der Künste, wird 1977 mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet und darf ins westliche Ausland reisen.
Die Probleme zwischen dem Staat und der prominenten Schriftstellerin werden im 1979 erschienenen "Kein Land. Nirgends" sichtbar. Anhand einer fiktiven Begegnung zwischen Heinrich von Kleist und der romantischen Dichterin Karoline von Günderrode setzt sich Christa Wolf mit der Frage des Scheiterns des Schriftstellers in der Gesellschaft auseinander. Es fällt schwer, Sätze wie "Da ich mich auf List und Verschmitztheit nicht verstehe, habe ich schweigen gelernt" nicht als Kommentar der Haltung der Autorin zu ihrem Staat zu verstehen.
Anerkennung im Westen
Dabei ist die Erzählung auch ein Beispiel für Wolfs literarischen Anspruch. Sprachliche Klischees vermeidend, arrangiert die Autorin die Stimmen der Personen in einem komplexen Gewebe. Wer spricht, was Rede, was nur Gedanke ist, wird ebenso absichts- wie kunstvoll verwischt. Die Ehrungen im Westen - unter anderem erhält sie mit dem Büchnerpreis im Jahr 1980 die bedeutendste Literarurauszeichnung der Bundesrepublik - sind daher auch nicht als "Belohnung" für eine systemkritische Haltung, sondern als Anerkennung ihres literarischen Schaffens zu werten.
Die gesamtdeutsche Schriftstellerin - "Kassandra"
Das Werk der humanistischen Werten verpflichteten Autorin repräsentiert eine engagierte Literatur in der Tradition Brechts. Wolf versucht, eine der Komplexität ihrer Themen angemessene Form zu finden. Die Reduktion ihrer Anliegen auf einfache Schwarz-Weiß-Schemata ist ihre Sache nicht.
Dabei trifft sie insbesondere mit "Kassandra" (1983) über Fragen der Gleichberechtigung und "Störfall" (1987) über die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl den bundesrepublikanischen Zeitgeist der 80er-Jahre. Im Gegensatz zu vielen ihrer ostdeutschen Kollegen gilt sie der westdeutschen Kritik als "gesamtdeutsche" Schriftstellerin.
Vorwurf der Regime-Nähe
Wolfs Liaison mit dem westlichen Zeitgeist findet mit der Wende in der DDR ihr abruptes Ende. Wolf hofft, ihre Utopie eines sozialistischen Staates mit menschlichem Antlitz könne jetzt verwirklicht werden.
Als "Wir sind ein Volk"-Rufe längst die Montagsdemonstrationen beherrschen, spricht sie sich gegen eine Wiedervereinigung mit der BRD aus, widersetzt sich so dem Einheitstrubel. Das macht sie in den Augen des westdeutschen Feuilletons verdächtig. Wie vielen DDR-Intellektuellen, die sich mit dem System arrangiert hatten, wird ihr nun die Nähe zum Regime zum Vorwurf gemacht.
Was bleibt
Wolfs Bericht über ihre Erfahrung als Zielobjekt der Staatssicherheit - der 1990 erschienene Text "Was bleibt" - trägt ihr unter anderem von Marcel Reich-Ranicki das Etikett "DDR-Staatsschriftstellerin" ein und löst eine Debatte über die Rolle der ostdeutschen Intellektuellen aus. Wolf hätte - so der populärste Vorwurf - ohne Rücksicht auf persönliche Konsequenzen den Text zehn Jahre früher publizieren müssen. Angesichts der Repressalien gegen Regimekritiker sei die Beeinträchtigung von Wolfs Privatleben durch die Aktivitäten der Staatsicherheit marginal.
Vor dem Fall der Mauer wäre die Veröffentlichung des Textes eine Sensation gewesen, danach sei sie nur noch "peinlich", urteilte Ulrich Greiner in der "Zeit". Viele, die ihr Werk zuvor gepriesen hatten, äußern plötzlich auch literarische Vorbehalte: Eigentlich habe man sich beim Lesen ihrer Bücher schon immer gelangweilt, hieß es schließlich.
Im Sinne der Stasi "unbrauchbar"
1993 wird bekannt, dass Christa Wolf von 1959 bis 1962 zunächst als "Gesellschaftliche Mitarbeiterin" und dann als IM "Margarethe" von der Stasi geführt worden war. Als moralische Instanz gilt sie daraufhin vielen als diskreditiert.
Nachdem die Staatssicherheit an sie herangetreten war, hat Wolf sich offenbar mit der Situation zu arrangieren versucht. Ihre wenigen Berichte über Schriftstellerkollegen enthalten nur Positives. Wegen "Unbrauchbarkeit" der Wolfschen Beobachtungen beendet Mielkes Geheimdienst dann auch das Engagement der Autorin. Ihre Stasi-Akte aus dieser Zeit veröffentlicht Wolf 1993 unter dem Titel "Akteneinsicht Christa Wolf" selbst.
Noch einmal Bestseller tauglich
Es schien lange Zeit, als sei mit der Wiedervereinigung die Rolle der "gesamtdeutschen Schriftstellerin" überflüssig geworden. Wolfs im vereinigten Deutschland veröffentlichte Werke fanden zunächst nicht mehr die gleiche Resonanz, wie die zu DDR-Zeiten verfassten Werke.
Sie überkomme das Gefühl, "einer überholten, aussterbenden Art anzugehören, deren Erfahrungen nicht mehr gebraucht werden", resümierte Christa Wolf ihre Stellung im kulturellen Leben des vereinigten Deutschlands - offenbar zu Unrecht: 2010 stieg ihr viel diskutierter neuer Roman "Stadt der Engel" auf Anhieb in die Bestsellerlisten ein. In dem Buch, für das sie den Uwe-Johnson-Preis erhielt, vermischte Wolf autobiografische Erlebnisse, wie ihre Zeit in Los Angeles Anfang der 90er-Jahre und die damaligen Diskussionen um ihre einstige Stasi-Mitarbeit mit fiktiven Inhalten.
Schlagwörter zu diesem Artikel
Porträt