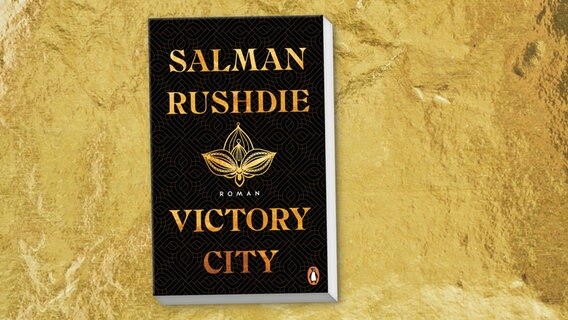Daniel Kehlmann über Salman Rushdie: "Wach, neugierig, präsent"
Salman Rushdie bekommt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sein langjähriger Freund Daniel Kehlmann hält das für "eine großartige Wahl". Im Interview spricht er über seinen Schriftstellerkollegen.
Herr Kehlmann, was war Ihr erster Gedanke, als Sie die Nachricht gehört haben?
Daniel Kehlmann: Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich finde das eine großartige Wahl. Das ist auch nicht selbstverständlich: Man hört ja, dass es immer wieder Preise gibt, wo Salman Rushdie in der engeren Wahl ist, und dann haben plötzlich die Juroren doch Sorge vor möglichen negativen Reaktionen von Seiten der Gegner der freien Rede. Das ist natürlich fantastisch, dass es in diesem Fall nicht der Fall war.
Gerüchteweise wurde er im vergangenen Jahr auch für den Literaturnobelpreis gehandelt, hat ihn dann aber nicht bekommen. War das eine Enttäuschung? Und ist dieser Friedenspreis vielleicht so eine Art Ausgleich?
Kehlmann: Ob das ein Ausgleich ist, das weiß ich nicht. Aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass er den Nobelpreis im letzten Jahr bekommen hätte, und ich hätte das auch für ein sehr starkes Signal gehalten. Aber es ist ja nicht aller Tage Abend, es wäre auch nächstes Jahr ein starkes Signal. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben.
Haben Sie ihm denn heute schon gratuliert?
Kehlmann: Nein, ich nehme an, dass er noch schläft. Es ist ja noch relativ früh in New York. Aber ich werde es gleich tun.
Wie haben Sie ihn denn kennengelernt?
Kehlmann: Er und ich haben neulich darüber geredet, und wir konnten es gar nicht mehr rekonstruieren. Ich glaube, es war ungefähr im Jahr 2006 oder 2007 auf dem damaligen PEN World Voices Festival in New York. Salman war damals noch - oder bis vor kurzem - Präsident von PEN America gewesen und war bei dem Festival sehr engagiert. Ich glaube, dass wir uns dadurch kennengelernt haben. Wir haben auch einige gute gemeinsame Freunde: Ian McEwan und der leider gerade verstorbene Martin Amis. Ich habe das Glück, einige Leute um Salman sehr gut kennengelernt zu haben, und da hat sich alles ganz von selber ergeben über die Jahre.
Wie würden Sie Ihre Freundschaft beschreiben?
Kehlmann: Es ist erstaunlich, weil man annehmen würde, wenn ein Schriftsteller so berühmt und auch um einiges älter ist wie Salman Rushdie, dass er dann eine Art väterliche, mentorhafte Position einnimmt. Das passt aber gar nicht zu ihm, daher ist es auch nicht der Fall. Er ist der wachste, neugierigste und in gewisser Weise geistig jüngste Mensch, den man sich vorstellen kann. Wir reden von gleich zu gleich - er redet aber auch mit meinem Sohn von gleich zu gleich - über Baseball oder über Marvel-Serien und Marvel-Filme, die er sich auch anschaut, weil er sich alles ansieht und weil ihn alles interessiert. Er liest alles, und er sieht alles, und dazu gehört auch Popkultur im weitesten Sinne. Kurz vor dem schrecklichen Attentat lief die "Obi-Wan Kenobi"-Serie. Ich habe sie mit meinem Sohn in Berlin angesehen, und wir fanden sie furchtbar. Und Salman, der sie auch furchtbar fand, hat sie zur gleichen Zeit in New York gesehen, und wir haben immer Text-Messages getauscht. Ähnlich war das auch bei der "Lord of the Rings"-Serie, die er aber so furchtbar fand, dass er nach vier Folgen aufgehört hat, sie zu sehen - wir haben ein bisschen länger durchgehalten.
Wir reden viel über Bücher - aber nicht nur. Ihn interessiert wirklich alles. Er ist wach, präsent und jung. Das merkt man auch in seinen Büchern: Er nimmt die Zeit ganz in sich und in die Bücher auf. Deswegen haben sie so etwas Pralles, Buntes und Volles, weil ihm nichts, was in der Welt passiert, fremd ist.
Wie geht es ihm denn heute, nach diesem verheerenden Anschlag im vergangenen Jahr?
Kehlmann: Erstaunlich gut, unter den gegebenen Umständen. Er hat ja ein Auge verloren, er hat aber keine Schmerzen mehr. Man muss sich das wirklich vorstellen: Das waren über 15 Messerstiche, die meisten davon ins Gesicht und in den den Halsbereich. Er benutzt das Wort "Wunder" nicht, aber metaphorisch kann man schon sagen, dass es ein Wunder ist, dass er das überleben konnte, und auch ein Zeichen, dass diese unglaubliche geistige Widerstandskraft, die er hat, auch der körperlichen Widerstandskraft entspricht. Abgesehen von der offensichtlichen Verletzung, die zum Verlust des Auges geführt hat, ist er so ziemlich der Alte.
Er wird mit dem Preis für seine Unbeugsamkeit und Lebensbejahung geehrt - so steht es in der Begründung. Das würden Sie ihm sicherlich auch zuschreiben, oder?
Kehlmann: Ja, das trifft es perfekt. Er ist unbeugsam gegenüber Hindernissen, wo ein Zehntel dieser Größe eines Hindernisses andere Menschen bereits völlig umwerfen und paralysieren würde. Diese Begründung hätte man gar nicht besser erfassen können.
Was schätzen Sie an seinem Werk so besonders? Was macht ihn als Schriftsteller aus?
Kehlmann: Das kann man inzwischen sogar schon literaturgeschichtlich beantworten. Er ist eine Gründungsfigur einer ganzen literarischen Bewegung. Das, was im weitesten Sinn "postcolonial literature" heißt, hat wesentlich mit ihm angefangen. Dass Menschen aus der Peripherie des ehemaligen englischen Weltreiches kürzlich angefangen haben, ihre Stimme literarisch zu erheben und die Vergangenheit und die Gegenwart aus ihrer Sicht zu erzählen - von dieser Bewegung war er der wichtigste und weitreichendste Vertreter. Es ist einfach ganz große Literatur. Seine große Tragik ist eigentlich, dass sein wichtigstes und bedeutendstes Werk, "Die satanischen Verse", durch die Fatwa und durch die politischen Verwicklungen für lange Zeit nicht mehr in dem Ausmaß als Literatur wahrgenommen wurde, wie es das eigentlich müsste. Es ist eines der großen literarischen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, und es wird jetzt wieder mehr als literarisches Werk gelesen. Um unsere Zeit zu verstehen, um religiösen Fanatismus zu verstehen, um so viele Phänomene in Zusammenstoß von dem, was man ganz unpräzise Ost und West nennt, besser zu verstehen, muss man immer wieder "Die satanischen Verse" empfehlen. Oder auch seine fantastische Autobiografie "Joseph Anton", in der er die Geschichte der Fatwa erzählt. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die naturgemäß nur er erzählen kann. Um auch ein weniger bekanntes Werk von ihm zu nennen: "Shame", ein ganz toller, knapper, stilistisch sparsamer Roman über Korruption und den seltsamen religiösen Staat, der Pakistan geworden ist. Ein unterschätztes und nicht ausreichend bekanntes Werk von ihm.
Das Interview führte Julia Westlake.
Schlagwörter zu diesem Artikel
Romane