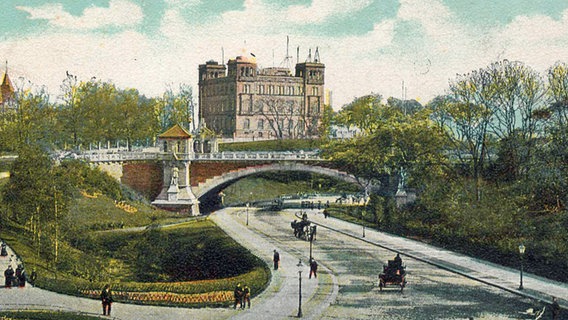Als 1984 ein Dioxin-Skandal Hamburg erschütterte
Vergiftetes Grundwasser, kranke Arbeiter: Als das Chemiewerk Boehringer in Hamburg am 18. Juni 1984 schließen muss, ist das Dioxin bereits überall. Die Sanierung des Geländes wird noch Jahrzehnte dauern.
Ein riesiger Parkplatz im Süden Hamburgs: Hunderte Lastwagen parken auf der Asphaltfläche an der Andreas-Meyer-Straße im Hamburger Stadtteil Moorfleet. Wer das Gelände betritt, steht auf einer der giftigsten Altlasten der Bundesrepublik. Pumpen fördern stündlich etliche Kubikmeter verseuchtes Grundwasser nach oben, eine Abwasserreinigungsanlage auf dem Gelände scheidet das Gift ab - sie arbeitet Tag und Nacht.
Dort, wo sich heute Lkw zum Verkauf aneinanderreihen, standen bis in die 1990er-Jahre die Fabrikhallen des Chemiekonzerns Boehringer Ingelheim. Bei dem Unternehmen ereignete sich einer der größten Umweltskandale in der Geschichte der Bundesrepublik, bis heute befinden sich tonnenweise Dioxin und andere Umweltgifte im Boden und im Grundwasser unter der 85.000 Quadratmeter großen Freifläche. In einer sogenannten Fahne - das sind die Grundwasserströme außerhalb des Werksareals - hat sich das Gift im Boden über eine große Fläche weiter verteilt.
18. Juni 1984: Chemie-Werk Boehringer muss schließen
Wie konnte es dazu gekommen? Ein Rückblick: Am 18. Juni 1984 muss das Werk des Chemiekonzerns Boehringer Ingelheim in Hamburg-Moorfleet schließen - die Fabrik kann damals Auflagen der Umweltbehörde nicht erfüllen. Wenige Wochen davor waren auf Altlasten-Deponien auf der Veddel und in Georgswerder mit Dioxin verseuchte Abfälle gefunden worden, die nachweislich von Boehringer stammen. Der Fall erregt bundesweit Aufsehen: Zum ersten Mal lässt eine deutsche Behörde einen großen Chemiebetrieb aus Gründen des Umweltschutzes schließen.
Dioxine breiten sich aus
Doch die Schließung kommt zu spät, das Gift ist bereits überall: im Boden, im Grundwasser, in der Luft, in der Milch der Kühe, die in der Umgebung grasten - und in den Körpern der Boehringer-Mitarbeiter. Viele von ihnen waren dem Dioxin ungeschützt ausgesetzt. Insgesamt sind rund 1.600 Boehringer-Arbeiter betroffen, zuletzt arbeiteten noch 240 Mitarbeiter in dem Werk in Moorfleet. Viele von ihnen erkranken in den Folgejahren an Krebs oder anderen Krankheiten, die mit Dioxin in Verbindung gebracht werden.
Ein Abschlussbericht aus dem Jahr 2011 konstatiert für die untersuchten Boehringer-Arbeiter nüchtern eine "signifikant erhöhte Mortalitätsrate" sowie "ein erhöhtes Risiko, an bösartigen Neubildungen" zu erkranken. Bei Frauen sei vor allem das "Risiko an Brustkrebs zu versterben, erhöht". Einer frühere Studie zufolge, die der Hamburger Senat 1991 veröffentlichte, erkrankten Arbeiter, die 20 Jahre bei Boehringer beschäftigt waren, doppelt so häufig an Krebs wie der Durchschnittsbürger.
Erste Mitarbeiter erkranken in den 1950er-Jahren

Dioxine sind äußerst langlebig und reichern sich in den Körpern von Menschen, Tieren und in Pflanzen an, zersetzen lassen sie sich nur durch sehr hohe Temperaturen. Sie sind Abfallprodukte, die bei verschiedenen Produktionsprozessen entstehen, bei Boehringer etwa bei der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln. Schon 1953 waren bei Boehringer in Hamburg die ersten Arbeiter an der sogenannten Chlorakne, einer typischen Erscheinung einer Dioxin-Vergiftung, erkrankt. Boehringer lässt die Produktion damals vorübergehend stoppen, nimmt jedoch 1957 mit einem neuen, als unbedenklich beurteilten Verfahren die Produktion erneut auf. Die dioxinhaltigen Produktionsabfälle schafft das Unternehmen auf die Altlasten-Deponie an der Müggenburger Straße auf der Veddel, später auf die Mülldeponie in Georgswerder.
"Prometheus" soll die Dioxine verbrennen
Der jahrzehntelange, sorglose Umgang mit den Giftstoffen rächt sich nach der erzwungenen Schließung: Rund 1.000 Tonnen Gift lagern in Fässern auf dem Werksgelände, hinzu kommen die dioxinlastigen Abfälle auf den Deponien. Was tun gegen das Gift, das bereits metertief in das Erdreich eingedrungen ist? Im November 1984 gründet Boehringer die Tochterfirma Dekonta, die Pläne zur Sanierung des Werksgeländes entwickelt. Das Unternehmen lässt die Hochtemperaturverbrennungsanlage "Prometheus" entwickeln. Sie soll den belasteten Boden auf 800 Grad erhitzen, sodass die Schadstoffe zunächst verdampfen und in einer zweiten Brennkammer bei Temperaturen um 1.200 Grad zersetzt werden können. Bis zu vier Meter tief wird der Boden ausgehoben, Pumpen sollen das verseuchte Grundwasser nach oben befördern, wo es gereinigt werden soll.
Erstes Sanierungskonzept scheitert
Doch der Plan geht nicht auf. Die aggressiven Stoffe beschädigen die Anlage, deren Abgase zudem weitere Umweltprobleme verursachen. 1994, zehn Jahre nach der Schließung des Werks, steht fest: Die Sanierung ist gescheitert.
Unternehmen und Stadt einigen sich auf ein neues Konzept: Sichern statt sanieren, heißt es nun. Das verseuchte Werksgelände erhält eine Art Betonsarg, es wird "eingekapselt", um zu verhindern, dass weitere Giftstoffe in das Grundwasser gelangen können. Rund herum wird eine unterirdische Betonwand gezogen, sie ist bis zu 50 Meter tief und 80 Zentimeter dick. Von oben verhindert eine Asphaltdecke, dass Regenwasser die Stoffe im Boden erneut löst, von unten dient eine undurchlässige Schicht Glimmerton als Boden. 1998 sind die Sicherungsarbeiten abgeschlossen, die Kosten trägt Boehringer Ingelheim.
Sieben Pumpen sind dauerhaft im Einsatz

Um das bereits vergiftete Grundwasser zu reinigen, sind zunächst fünf, seit 2016 - nach Beginn einer optimierten Sanierung - sieben Pumpen im Einsatz. Im Februar 2015 hatte sich das Unternehmen mit der Stadt und Umweltverbänden auf eine beschleunigte Sanierung ab 2016 verständigt. Der Chemiekonzern gibt bis 2027 zunächst 6,2 Millionen Euro aus, die Stadt einmalig 500.000 Euro dazu.
"Seit Inbetriebnahme der Wasserbehandlungsanlage im Jahr 1998 wurden rund 4,6 Millionen Kubikmeter Grundwasser gereinigt", teilt Boehringer Ingelheim dem NDR 2024 mit. Auf rund 172 Millionen Euro belaufen sich die Kosten der Sanierung bislang (Stand: Juni 2024). Das Geld stammt von Boehringer Ingelheim.
Das Unternehmen hat das Gelände verpachtet. Es wird den Angaben zufolge als "Truck Port" genutzt. Auf der versiegelten Fläche sei keine Natur vorhanden, sagt Maren Jonseck-Ohrt vom BUND im Gespräch mit dem NDR 2024.
Bis zum Jahr 2056 soll das Grundwasser entgiftet sein
Im Jahr 2056 soll die optimierte Sanierung enden. Bis dahin soll die Fahne mit dem verunreinigten Grundwasser aus dem Boden entfernt sein. Anschließend soll der Schadstoff-Abbau für weitere 40 Jahre überwacht werden - bis 2096. Doch auch nach dem Ende der Sanierung schlummert das Dioxin innerhalb des "Betonsargs" im Boden weiter. Boehringer Ingelheim teilt dazu mit: "Die Grundwassersicherung innerhalb der Kapsel (mit einer Dichtwand umschlossener Grundwasserbereich unterhalb des ehemaligen Werkgeländes) wird auch nach 2056 fortgesetzt." Dadurch würden auch weiterhin Schadstoffe aus dem Grundwasser entnommen und in der Wasserbehandlungsanlage entfernt.
BUND: Eine "Endlos-Aufgabe"
Alles in allem liefen die Sanierungsarbeiten inzwischen ganz gut, so Jonseck-Ohrt. Aber: "Es ist wichtig, dass auch über diese Zeiträume hinaus die Verantwortlichkeiten verbindlich geklärt sind. Auch die Betonkapsel hat nur eine endliche Lebensdauer", betont die BUND-Expertin. Das Ganze sei eine "Endlos-Aufgabe". Und: "Es wird immer etwas bleiben." Eine vollständige Entfernung aller Dioxin-Schadstoffe könne niemand garantieren. Auch wisse man nicht, ob das Grundwasser ansteigt, wenn die Wasserförderung und -reinigung irgendwann eingestellt würden, und dann wieder Dioxin freigesetzt würde. Die Beschaffenheit der Schichten in der Erde sei unterschiedlich. Dennoch sei es ein Ziel, auch "die Fahne zurückzuholen", das heißt so umfassend wie möglich zu dekontaminieren.
Erkrankte Ex-Mitarbeiter kämpfen um finanzielle Unterstützung
Das Dioxin hat sich aber nicht nur in Wasser und Boden abgesetzt, sondern auch in den Körpern der ehemaligen Boehringer-Mitarbeiter. Viele von ihnen wohnen damals direkt auf dem Gelände in Werkswohnungen. Etliche Beschäftigte, die sich um die Anerkennung einer Berufskrankheit bemühen, sind während der langwierigen Verfahren gestorben - häufig an Krebs, Nervenschädigungen oder anderen Leiden, die Mediziner mit Dioxinvergiftungen in Verbindung bringen. Bis Ende 2023 gibt es 667 sogenannte Berufskrankheiten-Anzeigen von ehemaligen Boehringer-Beschäftigten in Hamburg, wie die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie dem NDR mitteilt. Davon sind den Angaben zufolge 227 gemäß den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB VII - gesetzliche Unfallversicherung) anerkannt worden. Die betroffenen Mitarbeiter erhalten eine individuelle Rentenzahlung.