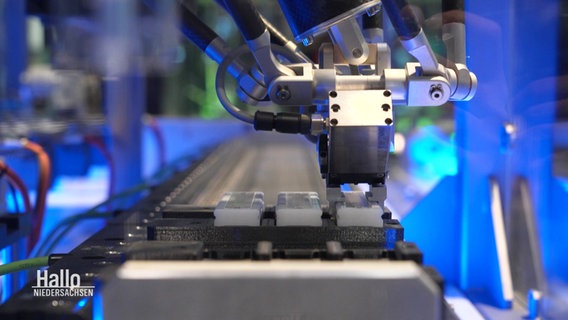Hamas-Überfall und Gaza-Krieg: Was denken Betroffene im Norden?
Vor einem halben Jahr überfiel die radikal-islamische Hamas Israel und ermordete mehr als 1.000 Menschen, mehr als 5.000 wurden verletzt, 240 als Geiseln nach Gaza entführt. Auch für viele Juden und Palästinenser in Norddeutschland ist das Leben seit dem 7. Oktober 2023 nicht mehr dasselbe.
Michal Hirsch befestigt eine gelbe Schleife als Symbol der Solidarität an einem Flyer. Zu sehen ist das Bild eines jungen Mannes. Seit einem halben Jahr ist der 21 Jahre alte Omer Shem Tov in der Gefangenschaft der Hamas. 134 Geiseln sollen es mittlerweile noch sein, wie viele davon noch am Leben sind - unklar. Hirsch organisiert mit einer kleinen Gruppe Freiwilliger immer sonntags einen Lauf an der Hamburger Außenalster. Auch jetzt, sechs Monate nach dem Anschlag.
Aktion in Hamburg für Freilassung der Geiseln
"Wer möchte, bekommt ein Bild einer Geisel und geht stellvertretend für diese Person eine Strecke", erklärt Hirsch. Die Idee kommt von der US-amerikanischen Graswurzel-Initiative "Run for their lives", die in etlichen Städten weltweit Mitstreiter gefunden hat. Hirsch ist beim Hamburger Ableger engagiert. Die Kinder der Israelin gehen in Tel Aviv zur Schule. Ihre jüngste Tochter war am 7. Oktober erst vier Wochen in Israel, wusste noch nicht einmal, wo die Luftschutzbunker sind. Gläubig ist die säkuläre Jüdin nicht, doch die jüdische Kultur und Geschichte seien ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben - der 7. Oktober habe ihr das noch einmal vor Augen geführt, sagt Hirsch.
Hass gegen Juden plötzlich spürbar
"Ich habe in kurzer Zeit die ganze Geschichte des Judentums gespürt: Diese Pogrome, die ich nur aus den Büchern kenne. Den Hass, den ich nur aus den Filmen kenne. Das Leid, das ich von meinen Eltern kenne, die Holocaust-Überlebende sind", erinnert sich Hirsch an den Tag des schrecklichen Überfalls auf Israel zurück. Die Bilder von Bodycams der Hamas-Terroristen, die um die Welt gingen, haben Spuren hinterlassen. Plötzlich spürte Hirsch ein Gepäck auf ihrem Rücken, das sie zuvor nie wahrgenommen hatte.
"Würde mir jemand helfen, wenn ich hier attackiert würde?"
An ihrem Hals trägt die 54-jährige eine lange Kette mit einem glitzernden Davidstern - sobald sie das Haus verlässt, stecke sie die Kette automatisch in den Pullover. In den Wochen nach dem Anschlag habe sie mit ihrer Familie nur selten die Wohnung verlassen. Dafür zog es sie für mehrere Wochen nach Tel Aviv, obwohl die Stadt zu diesem Zeitpunkt noch regelmäßig von Raketen beschossen wurde. Tatsächlich habe sie sich dort sicherer gefühlt: "Man ist zusammen in einer gefährlichen Situation. Dein Gegenüber und deine Nachbarn - zu denen übrigens auch die palästinensischen Israelis gehören, die dort wohnen - würden dir eher helfen, als wenn ich hier auf der Straße attackiert werden würde."
Persönliche Kontakte zu entführten Hamas-Geiseln
Hirsch kennt eine der Hamas-Geiseln persönlich. Auch für sie klebt sie Plakate mit den Bildern der Geiseln, organisiert Veranstaltungen, hilft wo sie kann. Ständig ploppen Nachrichten von Freiwilligen-Gruppen auf ihrem Smartphone auf. Ihrer eigentlichen Arbeit gehe sie nur noch sporadisch nach, so die Unternehmerin. Dann steigen ihr Tränen in die Augen: "Man kann nicht nicht dran denken - keine zwei Minuten. Das läuft immer im Hintergrund. Ich lebe nicht im April 2024, man ist ein Stück weit am 7. Oktober stecken geblieben." Daher müsse sie helfen, aktiv bleiben, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbringen. Mit dem sonntäglichen Lauf an der Alster wolle sie weitermachen, bis alle Geiseln zurück in Israel sind, ob tot oder lebendig.
Antisemitismus in Deutschland: "Die Mehrheit schweigt einfach"

Auch Viktoria Ladyshenski packt generell gerne an. Die Kielerin ist Geschäftsführerin der "Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein". Für ihr ehrenamtliches Engagement für jüdische Kultur und interreligiöse Dialoge mit Musliminnen und Muslimen hat sie bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten. Sie, die sich sonst für interkulturellen Austausch stark macht, vermisst seit dem Angriff Solidarität in der deutschen Gesellschaft. Es sei schwierig zu sehen, dass Juden mit der aktuellen Antisemitismus-Lawine allein gelassen würden: "Wir sehen keinen Aufschrei in der Gesellschaft, die Mehrheit schweigt einfach." Unter anderem Zahlen des Bundesverfassungsschutzes zeigen, dass antisemitisch motivierte Straftaten nach dem 7. Oktober extrem zugenommen haben.
Zäsur 7. Oktober: "Das ist ein Mini-Holocaust nach dem Holocaust!"
Ladyshenski berichtet von massiven Einschränkungen im Alltag: Männer könnten keine Kippa tragen. Jugendliche trauten sich in der Schule nicht zu erzählen, dass sie jüdisch sind. Es sei einfach zu gefährlich. In Hamas-Foren werde zur Vernichtung von Juden aufgerufen, der Hass auf Juden sei allgegenwärtig: "Wir würden uns wünschen, dass Menschen aufstehen und auf die Straße gehen." Nach einem halben Jahr seien nicht nur die schrecklichen Ereignisse vom 7. Oktober noch lange nicht verarbeitet - viele Jüdinnen und Juden müssten auch in Deutschland mit den Folgen leben, so Ladyshenski. Für viele sei der 7. Oktober eine Zäsur: "Das ist ein Mini-Holocaust nach dem Holocaust", so die Kielerin.
Bedrückende Unsicherheit, zerbrochene Freundschaften
Eliah Sakakushev-von Bismarck ist der Leiter der Villa Seligmann in Hannover. Die Kultureinrichtung zeigt Werke jüdischer Kulturschaffender und geht auf aktuelle Entwicklungen im jüdischen Leben in Deutschland ein: "Seit dem 7. Oktober 2023 berichten viele von einer bedrückenden Unsicherheit, von zerbrochenen Freundschaften und einer Zäsur im Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft", schildert Sakakushev-von Bismarck. Er wertet das als gewaltigen Einschnitt der Bestrebungen des Hauses, jüdische Identität sichtbarer und selbstverständlicher zu machen.
"Nach Gemeinsamkeiten suchen, nicht schweigen"
Sakakushev-von Bismarck trägt zum Beispiel durchgehend eine Kippa - auf der Straße bedeckt er seinen Kopf allerdings mit einem Hut oder einer Mütze, um sich den Stress potenzieller Anfeindungen zu ersparen. Dabei fühle er sich gut gewappnet, damit umzugehen. "Es ist meine Übersetzung, dass man als Jude oder Jüdin gerade in diesen Zeiten sehr selbstbewusst umgehen sollte. Das schafft wiederum Respekt", so der Cellist. Erfreulicherweise habe man an der Villa Seligmann bisher keine antisemitischen Anfeindungen erfahren, an einer Auseinandersetzung mit der veränderten gesellschaftspolitischen Lage komme das Haus trotzdem nicht vorbei. Trotz allen Herausforderungen werde die Kultureinrichtung nicht müde, nach Gemeinsamkeiten und Verbindungen zu suchen und diese zu betonen. "Das ist jetzt gefragt, nicht das Schweigen! Für diese Haltung sollte sich der Kultursektor jetzt entscheiden und handeln", so sein Appell.
Hamza Abed: Aus Gaza nach Kiel
Für ein Leben in Norddeutschland haben sich auch viele Palästinenser entschieden. Wie gehen sie mit dem Geschehen in ihrer Heimat um? Hamza Abed kommt aus Gaza-Stadt. Der 24-Jährige wollte eigentlich nur einen Monat in Kiel bleiben, um einen Teil seines praktischen Jahres als Arzt zu absolvieren. Dann überfiel die Hamas Israel und er konnte nicht mehr zurück. "Ich konnte das nicht glauben, hätte mir das niemals vorstellen können", erzählt er. "Ich war plötzlich von meiner Familie getrennt. Seit sechs Monaten lebe ich in ständigem Stress und in der Angst, dass ich sie jeden Moment verlieren könnte."
"Al-Schifa-Krankenhaus war Teil meines Lebens"
In den vergangenen Wochen haben ihn vor allem die Bilder vom Al-Schifa-Krankenhaus beschäftigt: "Ich habe dort schon gearbeitet, jetzt ist es total zerstört. Das macht mich trauriger, als dass mein Zuhause kaputt ist. Das Krankenhaus war ein Teil meines Lebens." In Deutschland seien die Menschen nett zu ihm, er habe nur gute Erfahrungen gemacht, sagt er. Häufig werde er auf die Lage in seiner Heimat angesprochen: "Am Anfang hatte ich noch die Energie, darüber zu sprechen, dann wurde es zu anstrengend. Ich versuche, über meine persönlichen Erfahrungen zu sprechen, wie ich dort gelebt habe. Meine Familie hat nichts mit Politik zu tun, nichts mit dem Krieg. Wir sind normale Menschen, wir haben Träume."
17 Verwandte tot - Vater mit Geschwistern auf der Flucht
17 seiner Verwandten habe er im vergangenen halben Jahr verloren, so Abed. Sein Vater sei mit seiner Frau und vier seiner Geschwister in den Süden des Gazastreifens geflohen. Er wolle sie gern aus dem Gazastreifen rausholen, sagt Abed. Er hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um sie in Sicherheit bringen zu können. "Die ägyptischen Behörden verlangen viel Geld von den Leuten, die rauswollen", sagt er. "Aber das ist die einzige Möglichkeit, die meine Familie hat, um diesem Krieg zu entkommen."
Einzige Hoffnung: Der Krieg soll beendet werden
Wenn er mit "seinen Leuten", wie er sie nennt, telefoniert, würden sie nicht darüber reden, wie es weitergehen kann: "Wenn jemand kein Essen und kein sauberes Wasser hat, ist es schwierig, über die Zukunft zu sprechen", sagt Abed. Er selbst möchte nach seinem praktischen Jahr, das er nun komplett in Kiel und Rendsburg absolviert, gerne in Deutschland bleiben und als Arzt arbeiten. Für seine Heimat wünsche er sich, "dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe".
Zeina Barakat leitet Friedensprojekt an Uni Flensburg
Hoffnung - sie verbindet Abed mit vielen anderen Menschen, auch mit der Soziologin Zeina Barakat. Die Palästinenserin lebt seit zehn Jahren in Deutschland, hat in angewandter Ethik promoviert. An der Europa-Universität Flensburg leitet sie ein israelisch-palästinensisches Friedensprojekt.

Gerade ist sie aber zu Besuch in ihrer Heimatstadt Jerusalem - das erste Mal seit acht Monaten. Ihre Eltern haben dort ein Geschäft in der Altstadt, sie verkaufen Kaffee und Nüsse. Seit dem Terrorakt und dem Beginn des Krieges sei ihr Umsatz um 30 Prozent zurückgegangen. "Die Osterzeit ist gerade vorbei, es ist Ramadan. Eigentlich sollten alle fröhlich sein. Aber in der Altstadt sind die meisten Geschäfte geschlossen, die Gassen leer", berichtet sie. "Und man kann es in den Augen der Menschen sehen: Sie haben zu kämpfen, sind verzweifelt." An ihren Rückflug möge sie noch nicht denken: "Ich habe ein schlechtes Gefühl, meine Familie zurückzulassen. Obwohl sie in Jerusalem leben, sind sie nicht in Sicherheit."
"Auf beiden Seiten Menschen, die das Leid der anderen sehen"
An den 7. Oktober vergangenen Jahres erinnere sie sich, als sei es gestern gewesen, sagt Barakat. "Ich war in Flensburg, sah die Bilder auf meinem Telefon, das Töten. Ich war geschockt. Es war für mich unvorstellbar. Ich habe meinen Bruder angerufen und ihn gefragt, ob das wirklich wahr ist." Die ersten drei Monate danach sei sie verzweifelt gewesen, habe ständig geweint, wenn über die Lage im Nahen Osten geredet wurde.
Von ihren Kolleginnen und Kollegen an der Uni bekomme sie viel Unterstützung. Gemeinsam sei es ihnen auch gelungen, einen palästinensischen Bewerber für ein Doktoranden-Programm aus dem Gazastreifen zu holen - auch dank der Hilfe seiner israelischen Kommilitonen, die 15.000 Dollar gesammelt hätten, um das Geld für die Grenzkontrollen Richtung Ägypten aufzubringen. "Das zeigt, dass auf beiden Seiten Menschen sind, die das Leid der anderen sehen", sagt Zeina Barakat.
Barakat: Kreislauf der Gewalt beenden
Wenn sie zurück in Flensburg ist, will die Soziologin weiter am Aufbau des Graduiertenkollegs arbeiten, das den Dialog und die Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern fördern soll - durch Bildung, Forschung und gesellschaftliches Engagement: "Wir arbeiten dort mit inzwischen 30 Studenten aus Krisenregionen an Themen wie Konfliktvermeidung und Konfliktlösung. Wir wollen ihre Perspektive weiten, in der Hoffnung, dass sie zu Botschaftern werden für Verständigung und Frieden."
Nach Jerusalem zurückkehren will Barakat nur noch für Familienbesuche. "Ich bin glücklich in Deutschland. Ich glaube, dass ich den Israelis und Palästinensern mehr mit meiner Arbeit hier helfen kann, in einem neutralen Land", sagt sie. "Gewalt ruft Gewalt hervor. Ich werde nie die Hoffnung verlieren, dass wir diesen Kreislauf eines Tages beenden und Frieden haben werden."