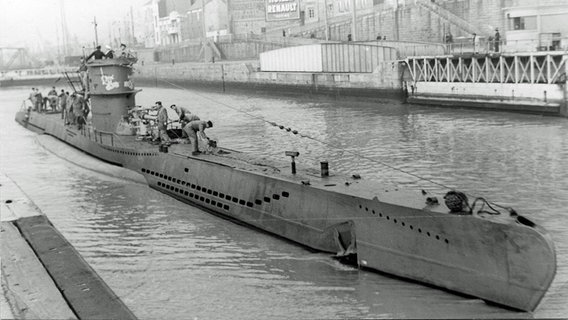"Eine Tragödie, die ich nie vergessen werde"
Am 22. September 2006 verunglückt der Transrapid auf der Teststrecke in Lathen im Emsland. 23 Menschen sterben, elf weitere werden zum Teil schwer verletzt.
Das Transrapid-Unglück ist einer der schlimmsten Zug-Unfälle in Niedersachsen in den vergangenen Jahrzehnten. Angehörige, Überlebende, Rettungskräfte und Reporter werden diesen Tag wohl kaum jemals vergessen. Journalist Joop Wösten wohnt und arbeitet im Emsland. Er war der erste Reporter am Unfallort und berichtete für einen Radiosender.
Wie begann der 22. September 2006 für Sie?
Joop Wösten: Ich war auf dem Weg zu einem Interview. Der Termin hatte mit dem Transrapid überhaupt nichts zu tun. Deshalb war ich auf der B 70 zwischen Haren und Lathen unterwegs. Dann bekam ich einen Anruf von einem Bekannten, der zufälligerweise gerade in Lathen in der Nähe der Transrapidstrecke war. Er hatte mitbekommen, dass da etwas passiert war. Es muss sehr laut gewesen sein. Also fuhr er hin, sah den Unfall und rief mich auf dem Handy an. Es hörte sich so abwegig an, dass der Transrapid verunglückt sein sollte, dass ich dachte: Da fährst du jetzt hin, das schaust du dir an. Ich war dann ungefähr gegen halb elf vor Ort. Das Unglück war da gerade eine gute halbe Stunde her.
Was waren Ihre ersten Eindrücke an der Unfallstelle?
Wösten: Es waren schon die ersten Rettungskräfte da. Sie holten einige Verletzte oben aus dem Zug. Es war sehr still. Eine Absperrung gab es noch nicht. Ich lief da herum und fühlte mich wie in einem schlechten Traum. So muss es nach einem Flugzeugabsturz aussehen, habe ich gedacht. Überall lagen Trümmer herum, aus denen es qualmte. Die Rettungskräfte waren mit großem Eifer dabei, die Verletzten zu versorgen. Einige schauten mich mit offenen Augen an, aber niemand hat etwas gesagt. Das ganze Szenario war total unwirklich. Ich habe gedacht, ich bin hier irgendwo hineingeraten, wo ich nicht hingehöre. Ich brauchte bestimmt fünf Minuten, um zu realisieren, dass das echt ist, was ich hier gerade sehe. Und ich fühlte mich auch etwas deplatziert, weil ich nicht helfen konnte.
Helfen oder berichten: War das ein Konflikt für Sie?
Wösten: Mir war schnell klar, dass ich mit meinem Erste-Hilfe-Kurs, den ich mal gemacht habe, mit Sicherheit nicht weiterkomme. Es waren zum Glück schon Rettungskräfte vor Ort, die das sehr professionell gemacht haben. Ich habe in dem Moment nur gedacht, dass ich keiner von den Journalisten sein will, die auch noch in das Wrack kriechen und die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit stören. Auf der einen Seite habe ich die journalistische Pflicht zu erfassen, was hier gerade passiert und darüber zu berichten. Aber ich kann das auch, indem ich nicht störe. Das ging mir durch den Kopf. Ich bin dann einige Meter an den Rand des Geschehens gegangen und habe versucht, keine Laufwege zu blockieren. Dort habe ich ein, zwei Leute angesprochen, die mir aber noch nichts sagen konnten.
Wie lief der erste Kontakt zu Ihrer Redaktion?
Wösten: Ich habe mit meinem Handy in Hannover angerufen und denen gesagt, was hier gerade passiert ist. Erst wollte mir niemand glauben. "Joop, das kann nicht sein. Das ist bestimmt eine Übung", sagten sie. "Nein, das hier ist eine Katastrophe", sagte ich. Die Kollegen aus Hannover haben dann bei der Polizei angerufen und sich bestätigen lassen, dass das keine Übung ist. Es klang so unvorstellbar, dass es niemand glauben konnte.
Und dann haben Sie berichtet.
Wösten: Ja, ich habe für die 11-Uhr-Ausgabe im Hörfunk erzählt, was ich sehe. Ich konnte aber noch nichts zu den Opferzahlen sagen. Ob es Tote gab und wie viele Verletzte: Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Es kamen immer mehr Rettungskräfte und die Polizei. Sie sperrten die Unglücksstelle bis zum Transrapid-Bahnhof ab, der knapp zwei Kilometer entfernt war. Die Journalisten mussten natürlich hinter der Absperrung Platz nehmen. Nach und nach kamen Kollegen dazu. Doch wir mussten erst einmal abwarten. Allmählich kamen dann die Zahlen von Verletzten und von den ersten Toten, die die Rettungskräfte entdeckt hatten.
Sie kommen selbst aus der Region. Hatten Sie Sorge, dass jemand in dem Zug sein könnte, den Sie kennen?
Wösten: Ein Bekannter von mir war Lokführer in der Transrapidbahn. Und ich habe gedacht: Was ist mit dem überhaupt? Vor dem Bahnhof stand damals ein kleiner Imbiss für die Touristen. Ich bin also zu diesem Imbisswagenbetreiber gegangen und habe ihn gefragt, ob er gesehen hat, ob mein Bekannter eingestiegen ist. Von seinem Standort konnte er das sehen. Er sagte: "Ich weiß nicht wie der heißt, aber der sieht so und so aus." Dann dachte ich den ganzen Tag, mein Bekannter war der Lokführer des Unfallzuges. Ich kannte auch seine Familie. Wenn man so eine persönliche Verbindung hat, ist es natürlich schwieriger zu berichten. Einen Tag später habe ich erfahren, dass mein Bekannter nicht im Zug war. Er war im Urlaub.
Wie kamen Sie vor Ort an Informationen?
Wösten: Wir waren auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof. Es kamen immer mehr Journalisten-Kollegen dazu. Die Rettungskräfte und Polizisten haben einen anderen Weg genommen und sind nicht an uns vorbeigefahren. Der damalige Landrat hat improvisierte Pressekonferenzen organisiert. Da wurden wir mit Informationen versorgt. Der Unfallort war zunächst eine No-Go-Area und wir hatten auch keinen Blickkontakt dorthin. Später wurden Busfahrten mit Journalisten organisiert, sodass man sich ein Bild machen konnte. Man bekam natürlich auch einiges mit, weil nach und nach die Angehörigen der Verunglückten eintrafen. Die sind zum Bahnhofsgebäude geleitet worden und wurden dort von Notfallseelsorgern betreut. Das eine oder andere drang auch zu uns Journalisten durch. Leider gab es auch "Kollegen", die sich als Feuerwehrleute verkleidet hatten und bis zum Unglücksort vordrangen. Widerlich!
Wie haben Sie an dem Tag gearbeitet?
Wösten: Ich habe ständig telefoniert, um zu erzählen, was da los ist. Mit meiner Redaktion und mit anderen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es war mit Sicherheit der größte mediale Auflauf, den ich in meiner beruflichen Laufbahn erlebt habe. Es waren zum Beispiel auch Kamerateams aus Japan da. Da habe ich mich gefragt: Wo kommen die denn so schnell her? Mit jeder Stunde gab es neue Zahlen über Verletzte und leider auch über Tote. Man wusste aber nicht, wie weit das noch geht und wie viele Menschen überhaupt in dem Zug waren. Die Tragödie nahm im Laufe des Tages ein immer größeres Ausmaß an.
Funktioniert man in einer solchen Ausnahmesituation nur noch?
Wösten: Man muss immer versuchen, professionell zu arbeiten. Dafür muss ich begreifen, was da passiert. Um seriös zu berichten, darf ich nicht nur schildern, was ich sehe, sondern brauche auch die Informationen. Und die haben mich natürlich nicht kalt gelassen. Ich habe versucht, das professionell rüber zu bringen, aber das ist nicht einfach so an mir vorbeigegangen.
Hatten Sie als Journalist eine Art Notfallplan für so ein schweres Unglück?
Wösten: Ich war zu der Zeit knapp zehn Jahre im Job. In dem Beruf war ich immer mal wieder bei Unglücken - meistens waren das Verkehrsunfälle oder Brände. In diesem Moment war natürlich das Zugunglück von Eschede in meinem Kopf. Da war ich selbst nicht vor Ort, aber ich weiß von Kollegen, was sie dort erlebt haben. Das ist jedoch so ein seltenes Ereignis, dass du dich nicht darauf vorbereiten kannst. Und speziell zum Transrapid: Ich bin Ende der 80er-Jahre selbst damit gefahren. Ich kenne fast niemanden, der das nicht gemacht hat hier im Emsland. Das war eine Technologie, die so sicher schien. Was sollte da passieren? So etwas hatte ich nicht im Kopf.
Wie endete der Tag für Sie?
Wösten: Ich bin gegen neun Uhr abends nach Hause gefahren, habe mich auf mein Sofa gesetzt und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ich wollte nicht mehr reden. Das war ein ganz seltsames Gefühl. Das werde ich nie vergessen. Ich war wirklich leer.
Wirkt dieses Ereignis bis heute nach?
Wösten: Ich war und bin nicht traumatisiert. Ich glaube, ich habe das schnell verarbeitet. Nach dem Unglück habe ich mit Helfern, die vor Ort waren und die ich kenne, gesprochen. Ich habe erfahren, dass zwei Bekannte von mir überlebt haben. Auch mit denen habe ich mich unterhalten. Ich wohne im Emsland und musste mich beruflich immer wieder mit dem Thema befassen. All das hat mir bei der Verarbeitung, beim Verstehen geholfen. Im Nachgang ist das natürlich eine Tragödie, die ich - wie sehr viele Emsländer auch - nie mehr vergessen werde.