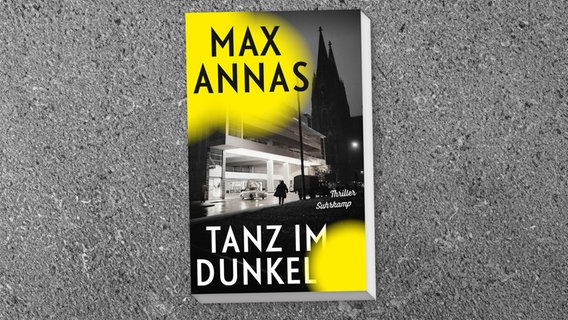Probleme in der Jazzszene: "Spielen bis die Zähne ausfallen"
Die Arbeitsbedingungen von freiberuflichen Jazzmusikern und Jazzmusikerinnen sind prekär: Häufig gibt es wenig Geld, keine Sicherheiten und kaum Altersvorsorgemöglichkeiten. Die Situation war nie einfach - in der Corona-Pandemie hat sie sich noch einmal verschlechtert.
Musikerin Stephanie Lottermoser weiß, was sie will: live spielen und komponieren. Gerade hat sie ihr sechstes Studioalbum "In-Dependence" herausgebracht. Es läuft gut für die Wahlhamburgerin. Trotzdem spürt sie die Auswirkungen der Pandemie: "Die letzten drei Jahre waren bisher die größte Herausforderung in meinem Beruf. Sie haben bewirkt, dass ich, wenn irgendetwas nicht klappt oder wenn irgendwo eine Unsicherheit entsteht, schlechter damit umgehen kann als früher." Stephanie Lottermoser spricht von "Schockstarren" und "Zukunftsängsten" - und das, obwohl sie noch nie so viel gearbeitet habe, wie in den letzten drei Jahren.
Mangelnde Altersvorsorgemodelle für Freiberufler
Die Deutsche Jazzunion hat im November erstmals seit sechs Jahren eine Jazzstudie veröffentlicht. Diese hat noch einmal bestätigt, was die Szene schon immer bestimmt hat: Teils prekäre Arbeitsbedingungen, unzureichende Altersvorsorgemöglichkeiten und auch eine überdurchschnittlich hohe psychische Belastung.
Was die Altersvorsoge angeht, so zahlt Stephanie Lottermoser, wie viele ihrer Kolleginnen auch, in die Künstlersozialkasse ein. Es bräuchte aber dringend weitere passende Vorsorgemodelle für Freiberufler, fordert die 39-Jährige: "Man hat als Freiberufler schwer die Möglichkeit, in manche Versicherungsmodelle reinzukommen - oder man muss dafür sehr viel Geld bezahlen. Das verdienen viele einfach nicht. Ich mache mir auch diese Gedanken und versuche, mich so gut ich kann, neben meinen KSK-Beiträgen abzusichern. Ob das dann später mal reichen wird, weiß ich natürlich nicht. Aber ich weiß, dass es noch nicht mal selbstverständlich ist, dass man überhaupt vorsorgen kann."
Uwe Granitza: "Ich muss spielen, bis mir die Zähne ausfallen"
Uwe Granitza ist Posaunist, Theatermusiker und ehemaliger Leiter der Roger-Cicero-Band. Er hat sich überlegt, wie er mit dem, was er verdient, privat vorsorgen könnte. "Das reichte nie. Ich habe vier Kinder und in den Zeiten, als sie klein waren, war das immer 'on the edge', dass wir überhaupt über die Runden kamen", berichtet er. "Mit dieser kleinen Episode mit Roger, war das schon wirtschaftlich ausreichend, aber da wurden dann Löcher gestopft, die vorher entstanden."
Was das für den Jazzer bedeutet? "Ich werde bald 62. Ich gehe davon aus, dass ich spielen muss, bis mir die Zähne ausfallen", sagt Granitza. Nun ist es so, dass er tatsächlich auch spielen will, bis ihm die Zähne ausfallen. Voller Lust, wie er sagt. Exemplarisch für viele Musiker.
Man könnte sagen: Uwe Granitza hat sich nicht für seinen Beruf entschieden, sondern der Beruf sich für ihn. Mit allen Konsequenzen: "Letztendlich ist es ein schwieriges Unterfangen, als Musiker zu überleben, und ich habe 36 Jahre professionelles Musizieren hinter mir", so Granitza. "Ich habe sehr viel Glück gehabt in der Zeit. Ich habe auch sehr viel Pech gehabt. Gerade in den letzten Jahren ist mir einiges entglitten, aber damit muss man zurechtkommen."
Jazzstudie: Schwierigkeiten der Szene sichtbar machen
Die Jazzstudie kann Schwierigkeiten sichtbar machen und ein klareres Bild des Berufs zeichnen - darauf hofft die Szene. Um dann, in einem weiteren Schritt, unterstützende Strukturen zu schaffen. Uwe Granitza hat da auch schon eine verrückte Vision: "die Bereiche Marketing, kaufmännische Belange und Buchhaltung und medizinisch-psychologische Versorgung in irgendeiner Form zu kanalisieren. Zum Beispiel so, dass es in Hamburg, Berlin, Köln und München Anlaufstellen für diese drei Belange gibt."
Geförderte Anlaufstellen, die - anders als Preise und Auszeichnungen - in die Breite wirken. Wo Musikerinnen und Musiker bei der Vermarktung, der Internetpräsenz, beim Ausfüllen der Steuererklärung oder bei psychischen Belastungen Unterstützung bekommen. Wo Veranstalter und Festivals direkt mit eingebunden werden.
Wenn es gut läuft, geben die Musiker*innen einen gewissen Prozentsatz ihres Gewinns an die Anlaufstellen zurück, ähnlich, wie es bei Agenturen gehandhabt wird. "Das halte ich für einen echten Booster!", findet Granitza.
Schlagwörter zu diesem Artikel
Jazz