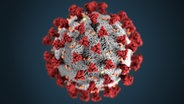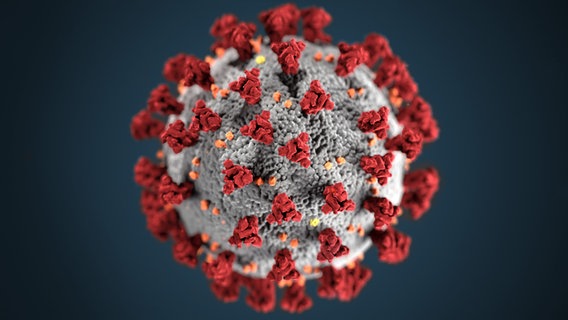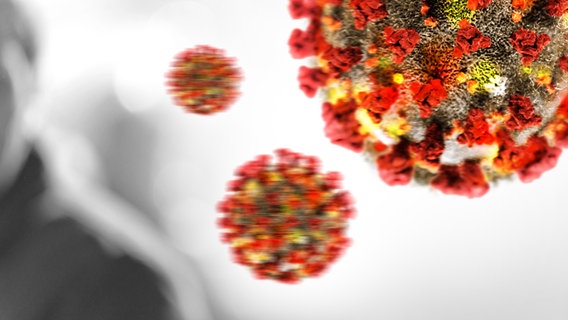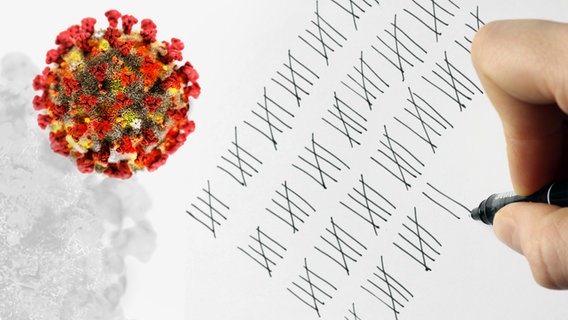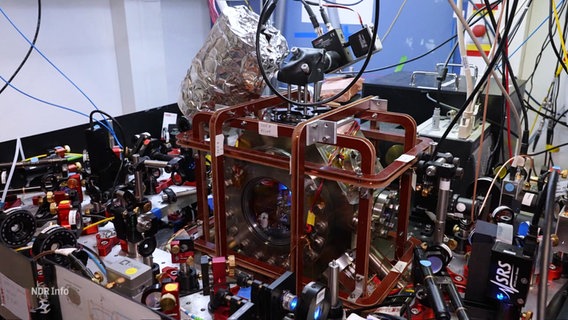Coronavirus-Update-Sonderfolge: Die Pandemie vom Menschen her denken
Regel-Wirrwarr oder "Killervarianten" - beim Reden über die Pandemie gab es viele Pannen. In der Sonderfolge des Podcasts Coronavirus-Update erklären Expertinnen, was man daraus lernen kann.
Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt ab, doch dreistellig sind die Inzidenzen immer noch und die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, denn nicht jeder lässt sich noch testen. Was bedeutet das, vor allem mit Blick auf die nächsten Monate? Es ist vor allem eine Frage der Risikowahrnehmung, Psychologie und Kommunikationswissenschaft kennen diesen Begriff schon lange und haben ihn gut erforscht. Doch wurden und werden sie überhaupt gefragt, wenn es um Aufklärung über Maßnahmen und ums Impfen geht? Darüber spricht die Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig in einer Sonderfolge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update mit den Psychologinnen Cornelia Betsch und Mirjam Jenny von der Universität Erfurt.
Die zentralen Themen der Folge im Überblick - per Klick direkt zur Textstelle springen
Definition Gesundheitskommunikation
Risikowahrnehmung und Wirklichkeit
Warum hat die Impfkampagne nicht alle erreicht?
Wie falsche Information stoppen?
Unterschied zwischen politischer Kommunikation und Gesundheitskommunikation
Vertrauensverlust in die Regierung
Corona-Kommunikation der neuseeländischen Regierungschefin Jacinda Ardern
Pandemie-Kommunikation in Dänemark
Lehren für die zukünftige Kommunikation
Mehr Wissenschaftstransfer und Wissenschaftskommunikation
Blick auf den Herbst und die Impfquote
Definition Gesundheitskommunikation
Korinna Hennig: Gesundheitskommunikation ist Ihr Fachbereich. Bevor wir auf der Sachebene in das Thema einsteigen, brauchen wir vielleicht ein bisschen Definitionshilfe. Was ist das eigentlich, Gesundheitskommunikation, und wofür brauchen wir das als Forschungsbereich?
Mirjam Jenny: Gesundheitskommunikation ist eigentlich ein Dialog. Es geht darum, Leute in ihrem Gesundheitsverhalten zu stärken, über die Gesundheit zu informieren und sogenanntes Shared decision-making zu ermöglichen. Also gemeinsames Entscheiden bei zum Beispiel größeren medizinischen Themen wie operativen Eingriffen oder Ähnlichem, aber auch für sich selber im Alltag gute Gesundheitsentscheidungen treffen zu können. Und um das zu stärken und die Leute darin zu stärken, braucht es eben die Forschung, wie man das am besten macht, wie man am besten zum Thema Gesundheit kommuniziert, Leute einbindet und so weiter.
Hennig: In der Pandemie hat das ja viel mit Risikowahrnehmung zu tun. Wenn man sich so umguckt, dann ist für viele in den Medien und der Politik die Pandemie kein Thema mehr, obwohl die Inzidenzen längst noch nicht im Bereich der ersten Wellen liegen. Sie haben zwar eine andere Bedeutung als damals, weil die Last in den Krankenhäusern geringer ist, aber es gibt nach wie vor Covid-Tote im 200er-, 300er-Bereich und viele Arbeitsausfälle, gefühlt jeder Zweite im Bekanntenkreis ist jetzt infiziert oder hat eine Infektion hinter sich.
Risikowahrnehmung und Wirklichkeit
Frau Betsch, diese Entwicklung dauert schon ein paar Wochen an. Was wissen Sie aus der letzten COSMO-Erhebung Mitte März über die Risikowahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger im Abgleich mit der Wirklichkeit?
Cornelia Betsch: Ja, das ist ganz interessant. Als wir noch Delta hatten, da konnten wir ziemlich genau sehen, dass die Fallzahlen was mit der Risikowahrnehmung zu tun hatten. Je mehr Fälle wir hatten, umso höher war das wahrgenommene Risiko, umso mehr haben sich die Leute auch freiwillig eingeschränkt, über die geltenden Maßnahmen hinaus auf Kontakte verzichtet. Und das hat sich, das konnten wir auch zusammen mit dem Robert Koch-Institut ausrechnen, tatsächlich auch auf den R-Wert ausgewirkt, wie die Leute ihr Verhalten verändern.
Also konnte man so richtig den Kreis von Fallzahlen, Risikowahrnehmung, Verhalten wieder zum R und der Ausbreitung des Virus sehen. Seit Omikron hat sich das verändert. Die Leute schneiden ziemlich genau mit, was passiert denn eigentlich gerade an der Virusfront? Viele nehmen jetzt wahr, dass sie sich vermutlich anstecken werden, also das wahrgenommene Risiko, sich anzustecken, ist ziemlich hoch.
Aber die Leute denken, wenn ich es bekomme, dann wird es vermutlich nicht so schlimm sein. Wir sehen ja auch weniger Hospitalisierungen als noch bei Delta. Also da sehen wir wirklich, dass sich das im Prinzip umgekehrt hat. Das führt auch letztendlich dazu, dass trotz dieser wirklich hohen Fallzahlen, die wir zwischenzeitlich hatten, das wahrgenommene Risiko gar nicht mehr so hoch ist, genau wie das freiwillige Schutzverhalten, was dann wiederum auch zu solchen hohen Fallzahlen geführt hat.
Hennig: Jetzt steht da aber der politische Kurs Richtung Freiwilligkeit, zum Beispiel beim Maskentragen. Haben Sie da schon Hinweise, was das für Auswirkungen hat? Ob jetzt trotzdem noch mal ein freiwilliges Schutzverhalten implementiert wird?
Betsch: Die letzten Daten, die wir hatten, waren zu einem Zeitpunkt, bevor das alles fiel, aber letztendlich ist im Moment das Problem, dass wir viel über Eigenverantwortung reden, aber das Eigenverantwortung gar nicht so richtig definiert ist. Also dass jeder denkt, Eigenverantwortung bedeutet: Ich muss gar nichts mehr machen, keine Maske tragen, keinen Abstand halten. Und es wird nicht gut erklärt, finde ich, dass es trotzdem noch um den Schutz vulnerabler Gruppen geht.
Der Begriff ist so ein bisschen, ich sage es mal flapsig, ausgelutscht. Und jeder denkt dann vielleicht an Alten- und Pflegeheime, weil das oft damit in Verbindung gebracht wurde. Aber es geht ja zum Beispiel auch um Leute mit chronischen Erkrankungen. Denen man das vielleicht gar nicht ansieht, dass sie vulnerabel sind. Und davon gibt es relativ viele. Und ich finde, dass das im Moment nicht sehr gut diskutiert wird.
Hennig: Da sind wir ja schon mittendrin in der Frage der Kommunikation solcher Erkenntnisse und solcher Risiken. Diese Risikowahrnehmung hat ja auch viel mit Prävention zu tun und die wiederum mit der Impfentscheidung. Frau Betsch, in Ihrer Habilitation haben Sie sich mit dieser Kausalkette schon beschäftigt. Es gibt ja noch andere Impfungen. Ich würde deswegen gern die Kommunikation über das Impfen in Deutschland ein bisschen näher betrachten, bevor wir dann noch mal versuchen, Erkenntnisse für die Krisenkommunikation im Allgemeinen abzuleiten.
Warum hat die Impfkampagne nicht alle erreicht?
Es ist bekannt, die Impfquote in Deutschland ist besonders unter den Älteren zu niedrig. Da werden auch die 80 Prozent mit dreifach Geimpften nicht erreicht. In Ländern wie Dänemark, aber auch zum Beispiel Spanien, liegt die Impfquote gerade bei den Älteren deutlich höher. Und irgendwie scheint sich in Deutschland seit Monaten wenig zu bewegen. Es gab aber Informationen. Es gab eine Impfkampagne des Bundesministeriums für Gesundheit, es gibt die Website "Zusammen gegen Corona", es gibt Medienberichterstattung. Nach wissenschaftlichen Kriterien betrachtet, Frau Jenny, was hat gefehlt? Warum hat das nicht gereicht?
Jenny: Vieles der Kommunikation ist nicht allzu allgemein verständlich. Beispielsweise "Zusammen gegen Corona", da sind zwar sehr, sehr viele fachlich sehr, sehr gute Informationen drauf, aber der Klickweg oder Leseweg, um wirklich zu den wichtigen Informationen zu kommen, auch dazu, was muss ich jetzt tun und warum, das ist wirklich sehr lange, komplex. Ich habe keine einfache Information.
Und wenn wir jetzt gerade über Webseiten sprechen, ist das ja auch ein Kommunikationsweg, der sozusagen voraussetzt, dass die Leute aktiv und selber auf so eine Seite gehen, aktiv selber Informationen suchen. Das machen natürlich einige, nur viele davon landen dann vielleicht auch auf schlechten Webseiten und nicht nur auf "Zusammen gegen Corona". Und andere sind es überhaupt nicht gewohnt, so richtig aktiv nach Informationen zu suchen. Die schauen sich ihre Information an, die so passiv, ich sage jetzt mal reingespült wird über Twitter-Feeds oder so. Da gibt es natürlich Informationen von "Zusammen gegen Corona" auf Social Media, das ist auch wichtig.
Aber dann gibt es natürlich noch Gruppen, die jetzt nicht groß auf Social Media unterwegs sind, die man vielleicht besser übers Fernsehen oder Radio ansprechen würde oder über Spots im Supermarkt. Die Spots selber habe ich auch schon gehört. Einfach so in die Gesellschaft rein und auch in ganz unterschiedliche Lebensbereiche, bis hin zu Gruppen, die jetzt vielleicht die Informationen auf anderen Sprachen brauchen, für sich vor Ort, oder auch die, die Informationen von Vertrauenspersonen, richtig in ihrer Community. Das ist ja auch dieses aufsuchende Informationsangebot. Und das, inklusive beispielsweise gute Werbespots habe ich eigentlich die ganze Zeit vermisst.
Hennig: Also es ist zu wenig zugänglich, zu aufwendig da ranzukommen, zu wenig niedrigschwellig. Aber Kommunikation ist ja normalerweise auch ein Spiel zwischen Sender und Empfänger. Information klingt eindimensionaler. Ist Information etwas anderes als Kommunikation? Muss man sein Gegenüber auch mehr fragen?
Jenny: Das ist der Idealfall: Wenn ich eine Gesundheitskommunikation entwickle, auch Formate entwickle, Videos, Texte und so weiter, dass ich natürlich mein Zielpublikum befrage, mit einbeziehe in die Entwicklung. Das ist natürlich in Krisenzeiten mit hohem Zeitdruck komplexer als in ruhigeren Zeiten. Es ist aber ein ganz wichtiger Teil.
Ich muss ja eigentlich wissen, was die Leute genau wissen wollen, dass es zum Beispiel ganz wichtig ist, erst mal die möglichen negativen Wirkungen von der Impfung zu besprechen und da auch Sorgen zu nehmen und die Leute auf Augenhöhe ernst zu nehmen. Das ganz persönliche Patientengespräch ist beispielsweise wahnsinnig wichtig, weil die Informationen, die ich an eine größere Masse gebe, kann ja nicht so personalisiert sein. Das ist dann wiederum im Zweiergespräch viel besser möglich.
Politische Entscheidungsfindung
Hennig: Das machen Sie in der COSMO-Studie aber auch, Frau Betsch. Sie fragen, wo Unsicherheiten sind. Sie fragen ja nach dem Wissen über die Dinge, die die Pandemie bedingen, die Informationen, die da ankommen oder auch nicht. Werden solche Datensätze von der Politik in der politischen Entscheidungsfindung zur konkreten Umsetzung angefordert und genutzt, also in der Planung der Impfkampagne zum Beispiel?
Betsch: Ja, jetzt kürzlich haben wir uns da intensiver drüber ausgetauscht. Wenn man sich jetzt "Zusammen gegen Corona" über das Impfen anschaut, muss man sagen, ist da auch deutlich was passiert. Sagen wir mal, noch vor einem halben Jahr oder vielleicht sogar noch kürzer war das im Prinzip eine behördlich abgelegte Wissenssammlung. Alles, was wir seit der Impfpriorisierung an Wissen gesammelt haben, war da aufgeführt. Und das ist natürlich nicht das, was der Endnutzer sucht.
Man muss es sich immer vorstellen wie bei "Good Bye, Lenin", den Film kennen vielleicht einige: Da wacht jemand aus dem Koma auf und es gibt die DDR nicht mehr. Und so muss man sich im Prinzip, finde ich, den idealen Endnutzer vorstellen. Jemand wacht auf, denkt, es ist Pandemie. Vielleicht informiere ich mich doch mal über das Impfen. Es gibt so Leute, die dann irgendwie doch das Bedürfnis entwickeln. Und was müssen die wissen? Was wollen die auch wissen?
Und dazu können die COSMO-Daten schon ziemlich gute Informationen geben. Also die Hauptinformation, die die Leute wichtig finden, ist natürlich die Sicherheit. Aber auch, wie komme ich zu dem Termin? Also wie kann ich impfen möglichst einfach machen. Das war vorher vor der grundlegenden Überarbeitung schon relativ schwierig, das zu finden. Und da haben wir auch viel darüber gesprochen, wie machen das andere Länder?
Kommunikationsvorbild Dänemark
In Dänemark war das ganz hervorragend aufbereitet. Man stellt sich in die Schuhe des Nutzers und denkt aus dieser Perspektive darüber nach: Was braucht die Person jetzt? Was will sie tun? Was fragt die sich? Und die COSMO-Daten wurden jetzt zu der Überarbeitung benutzt. Und auch für die Plakataktion wurde uns rückgemeldet, dass da viel genutzt wurde. Wir sind da nicht im Prozess dabei, das liegt dann natürlich in der Hand von den Agenturen oder eben auch den entsprechenden Stellen, die die Kommunikation dann verantworten, aber die Daten werden jetzt mittlerweile deutlich stärker genutzt als noch am Anfang.
Hennig: Es ist natürlich trotzdem relativ spät, weil die Impfkampagne läuft ja schon länger. Dieses Problem mit dem aufsuchenden Impfen und auch mit der aufsuchenden Information, also Impfung und Information dahin bringen, wo die Menschen ohnehin schon sind, nicht andersrum, gilt das eigentlich für bestimmte Bevölkerungsgruppen? Ich sage mal, der gutverdienende Akademiker kann ohnehin an die Informationen drankommen, die er braucht? Oder geht das eigentlich quer durch? Was für Erkenntnisse haben Sie da?
Betsch: Ich glaube, was sich schon gezeigt hat, ist, dass noch mal aktiv auf Menschen, die nicht Deutsch sprechen, zugegangen werden sollte. Da hat man auch in Daten vom RKI gesehen, dass die Impfbereitschaft eigentlich ziemlich hoch ist, aber dass da oft nicht so richtig klar ist, wie komme ich da ran? Oder dass Fragen nicht richtig beantwortet werden.
Da wird eben auch immer wieder klar, es reicht halt nicht, Flyer in allen möglichen Fragen vorzuhalten und die auf irgendeiner Webseite zu parken, sondern man muss wirklich mit den Informationen zu den Menschen hin. Also mir schwebt da ein Beispiel aus Australien vor. Die haben Menschen, die besonders engagiert sind beim Impfen, Bürger einfach, die Impfen gut finden, zu Webinaren eingeladen und haben die informiert, wie man gut übers Impfen redet.
Impf-Champions
Die wollten sich zu Champions ausbilden lassen und haben dann als Multiplikatoren gewirkt. Und da gibt es in manchen Bundesländern oder manchen Städten, Kommunen auch Aktivitäten, wo Leute in ihrer Sprache Leute aus ihrer Community ansprechen und übers Impfen informieren. Das hat natürlich eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Man hat eine ganz andere Basis, sowohl kulturell als auch sprachlich. Man kann vielleicht Fragen besser formulieren, man versteht die Antworten anders.
Das sind alles Modelle, die werden teilweise jetzt auch umgesetzt. Also da gibt es Aktivitäten. Ich glaube, zusammen mit "German Dream", so heißt das, wo man in Communities reingeht. Und ich glaube, das ist etwas, was man an manchen Stellen relativ früh verstanden hat. Aber wo wir großflächig das Problem haben, dass nicht so richtig klar ist, wie können wir eigentlich voneinander lernen?
Also in jeder Community, in jeder Kommune, in jeder Stadt muss das selber erfunden werden, sage ich jetzt mal. Und bis dann mal Best Practices ausgetauscht werden, das dauert einfach. Dafür haben wir nicht so richtig die Strukturen. Ich glaube, daran hat relativ viel gekrankt in der Pandemie, dass man ja dadurch, dass jeder selber informieren darf und will, auch jedes Bundesland einen eigenen Flyer zum Impfen macht oder ein eigenes Infoportal programmieren musste und so weiter, unglaublich viel Ressourcen dafür aufgewandt werden.
Abhängig von Ressourcen
Und es kann halt auch nicht jeder gleich gut machen, weil nicht überall die Ressourcen gleich sind und weil vielleicht auch nicht jeder die gleiche Beratung hat. Deswegen, also man muss ja nicht immer alles zentralistisch betrachten, aber ich glaube, hier würde man schon davon profitieren, wenn an einer Stelle mit Sinn und Verstand Dinge entwickelt werden und dann weitergegeben.
Und ich glaube, dass da einfach auch der Föderalismus oder das Aufteilen auf die Kommunen ein zweischneidiges Schwert ist. Man braucht ein bisschen Ownership, also die Leute sollen das Material, was man entwickelt ja auch selber gut finden und vertreten können. Und vielleicht findet der Bayer das, was in Thüringen entwickelt wurde, nicht so gut und umgekehrt. Aber ich glaube, da kann man eigentlich viel Ressourcen sparen, wenn man da eine zentrale Stelle hätte, die sehr gute Information entwickelt, die dann adaptierbar ist.
Hennig: Beim Stichwort adaptierbar: Wie wichtig ist es denn, wie verbindlich und persönlich so eine Einladung zum Impfen ist? Es war ja in Deutschland so, dass in der allerersten Phase viele Enkelkinder neben ihren Großeltern saßen und versucht haben zu helfen, online einen Impftermin zu buchen. In anderen Ländern wurde man angeschrieben, hat vielleicht auch gleich einen Termin bekommen. Ist solche persönliche Ansprache, vielleicht auch in einem Dorf vom Bürgermeister angeschrieben werden, tatsächlich messbar unterschiedlich? Macht das einen Unterschied?
Jenny: Da gibt es Studien, dass es wirkt, wenn man persönlich angeschrieben wird, vielleicht sogar schon mit einem Termin: "Ihr nächster Impftermin ist dann in diesem Impfzentrum oder bei dieser Ärztin", die Leute müssen dann natürlich absagen oder verschieben, wenn sie nicht können, aber sie fühlen sich halt angesprochen und haben ihren persönlichen Termin zum Hingehen. Das kann gut funktionieren. Das habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Und das umgeht ja auch, in irgendwelchen komplizierten Systemen den Termin buchen zu müssen. Diese Hürde fällt auch weg.
Gründe für Impfskepsis
Hennig: Wir waren auch bei der Frage: Was weiß man denn tatsächlich über das Impfen? Und auch bei der Frage der aufsuchenden Impfinformation, also zu gucken, wo sind denn die großen Fragen tatsächlich? Wenn man sich anguckt, was es für Gründe für Impfskepsis gibt, dann gibt es ja ganz verschiedene Motive.
Die Forschung unterscheidet da auch zwischen Verschwörungserzählungen und Desinformation und Fehlinformation. Also wird etwas gezielt verbreitet oder sind es Fehlinformationen, die vielleicht auch versehentlich unter sogar informationswilligen Menschen verbreitet werden, die dann einfach was missverstanden haben und das dann auch noch weitertragen. Wie wichtig ist es, dass man da nach Zielgruppen differenziert? Was kann man da tatsächlich tun, um Fehlinformationen frühzeitig zu stoppen?
Betsch: Ich glaube, insgesamt fehlte in Deutschland so eine Art "Frag doch mal die Maus". Da habe ich vorhin dran gedacht. "Frag doch mal Dr. Moder" oder "Frag doch mal Dr. Addo". Ein Format, wo man vertrauenswürdige Informationen gut erklärt bekommt. Es wird immer wieder gesagt: "Oh Gott, das Video von Herrn Bhakdi wird 100.000-mal geklickt". So viele Leute glauben so einen Stuss. Ich würde ja immer eher denken, so viele Leute haben diese Frage und suchen auf diese Frage eine Antwort.
Ich glaube, was wir hier im Umgang mit Falschinformationen lernen müssen, ist, dass vollkommen klar ist, dass Leute in einer Situation von maximaler wissenschaftlicher Unsicherheit auch sehr viele Fragen haben, die sie beantwortet haben möchten. Und oft hilft es schon zu sagen: Über diese Frage wissen wir noch nichts, wir tun aber dieses oder jenes, um diese Frage zu beantworten. Das ist auch schon eine Antwort. Das schließt die Lücke in meinem Puzzle, das ich im Kopf habe. Und das Problem ist häufig, dass eben solche Verschwörungserzählungen oder Desinformationen relativ einfache Antworten auf komplexe Fragen geben.
Und deswegen sind die natürlich auch so attraktiv. Wenn ein Angebot fehlt, das jeder kennt und wo man einfach hingehen kann, wenn man eine Frage hat und wo man dann auch Antworten findet, dann können sich eben solche Falschinformationen, Desinformationen festsetzen.
Jenny: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zum Thema Impfen und Desinformation, und diese Impf-Champions oder Impf-Lotsen, wie sie hier manchmal auch genannt werden: Also Bürgerinnen, die dann darin gestärkt werden, zu den Themen zu kommunizieren. Es gibt ja zum Beispiel das Debunking Handbook oder Impfkommunikationshandbook.
Das gibt ja auch Tipps zum Umgang mit Falschinformationen, und auch diese Kommunikation kann von Peers kommen. Und was wir im Gesundheitsbereich nicht vergessen dürfen, ist, dass viele Leute auch ihre medizinischen Entscheidungen in der Familie diskutieren, mit Freunden, vielleicht mit guten Nachbarn und dass das auch eine Stärke von Impf-Champions ist, dass die Information dann eben von Leuten kommt, denen ich vertraue, und nicht nur Experten.
Wie falsche Information stoppen?
Hennig: Da sind wir jetzt aber im persönlichen Dialog. Aber wenn sich Falschnachrichten schon richtig weit verbreitet haben, dann wird es ja schon schwierig. Man weiß ja aus der Kognitionswissenschaft, dass es gar nicht so einfach ist, eine Falschnachricht im Gehirn wieder zu löschen.
Also ich denke zum Beispiel an die COVIMO-Befragung des Robert Koch-Instituts, also das Impf-Monitoring. Und da ist dokumentiert, dass fast die Hälfte der Befragten sich zuletzt nach wie vor in der Frage nicht sicher war, ob die Impfung nicht doch die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte. So was verbreitet sich über Social Media und wird dann hinaus in die Welt getragen.
Wie kann man konkret frühzeitig versuchen, eine wirklich falsche Information zu stoppen? Weil die Fehlinformation auch sehr pseudowissenschaftlich daherkam, also noch nicht mal besonders einfach, und es deswegen für manche vielleicht vertrauenerweckend erschien.
Jenny: Ja, da ist es wichtig, dass man einmal zum Beispiel von offizieller Stelle oder vertrauenswürdiger Stelle noch mal kurz sagt, was Fakt ist. Und dann zum Irrglauben kommt. Fakt ist, die Impfung hilft beispielsweise, es ist wichtig und so weiter. Und dann kommt man zum Irrglauben. Und jetzt denken einige Leute aus unterschiedlichen Gründen, dass die Impfung der Fruchtbarkeit schadet.
Da kann man vielleicht auch dazusagen, dass das ganz häufig bei Impfungen als Falschinformation passiert. So eine klassische Sorge, die die Leute dann haben, bei anderen Impfungen auch schon, dass es immer mal wieder grundlos aufkommt. Und dann muss man erklären, was der Trugschluss war, warum man zu dieser Sorge mit der Unfruchtbarkeit kam. Und am Schluss, ganz wichtig noch mal, die richtigen Fakten wiederholen. Also wie ein Sandwich. Erst richtige Fakten. Dann: Achtung, hier ist ein Irrglaube. Wo kommt der her? Und noch mal die wichtigen Fakten. Das könnte man natürlich auch als Kampagne aufbereiten.
Hennig: Aber birgt das nicht die Gefahr, wenn man so ein Gerücht aufgreift, dass man es dadurch noch verstärkt? Frau Betsch, Sie haben ja gezielt bei einem eigenen Kommunikationsprojekt zum Impfen in Thüringen genau dieses Gerücht für junge Leute aufgegriffen. Verstärkt man das nicht möglicherweise aus Versehen?
Betsch: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man das macht. Also dieses Fakten-Sandwiche, was Frau Jenny gerade beschrieben hat, das ist jetzt im Moment State of the Art: Dass man wirklich den Fakt betont und nicht die Falschinformation. Da sieht man dann aber auch, dass Medien in dem Prozess häufig eine Rolle spielen.
Dann wird in die Überschrift geschrieben: "Macht Impfung unfruchtbar?" Und dann gibt es einen Teaser. "Die COVIMO-Studie zeigt, die Hälfte ist sich nicht sicher." Dann macht das vielleicht viele Klicks, aber die Falschinformation wird quasi noch mal mit rotem, fettem Stift eingekreist. Da spielen natürlich viele Sachen mit. Wir interessieren uns mehr für Informationen, die uns sagen, da ist eine mögliche Gefahr, als wenn uns jemand sagt, das ist sicher. Das ist das eine. Und das andere, so was bleibt natürlich gut kleben.
Kritik an aktueller Impfkampagne
Da muss ich auch noch mal Kritik an der aktuellen Impfkampagne üben. Also es sind Plakate im Umlauf, ich weiß nicht, ob sie noch hängen. "Impfen hilft und macht nicht unfruchtbar" oder so ähnlich steht da drauf, wo eben auch noch mal diese Information an Litfaßsäulen an der Bushaltestelle breit geklebt wird. Also man kennt ja dieses Beispiel: "Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten". Da muss man wenig zu sagen, das funktioniert nicht gut.
Die Alternative dazu wäre vielleicht zu sagen: "Impfen schützt dich und dein Kind", was nämlich die eigentliche Botschaft ist. Also man kann auf einer großen Fläche sicherlich keine Falschinformation korrigieren. Das eignet sich dazu nicht. Da kann man nur einen kurzen Satz hinschreiben, der vielleicht Aufmerksamkeit generiert für ein Thema oder der auf eine Seite führt. Wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt die Neue “Frag doch mal die Maus“-Webseite rund ums Impfen, dann kann man die vielleicht auf großen Flächen bewerben.
Aber es funktioniert sicher nicht, zu sagen: "Impfen macht übrigens nicht unfruchtbar". Wir müssen uns vorstellen, das ist wie ein Puzzle in unserem Gehirn. Und wenn wir da ein Puzzleteil herausnehmen…. Man kann sich doch daran erinnern, wie blöd sich das als Kind angefühlt hat: Man war fertig und ein Teil fehlt. Und das mögen wir nicht. Das heißt, wir füllen Leerstellen zur Not mit falschen Informationen. Deswegen müssen wir, wenn wir ein Puzzleteil rausnehmen, auch diese Leerstelle wieder füllen. Also gut erklären: Wie kommt es zu dieser Falschinformation? Da gibt es Studien zu, die zeigen, dass es ganz gut funktioniert.
Hennig: Aber ist es keine Alternative zu sagen, wenn so ein Gerücht aufkommt: Wir versuchen, es zu ignorieren? Ich habe in der Vorbereitung den Begriff des "Social Listening" gelesen, also frühzeitig in sozialen Netzwerken zum Beispiel zu gucken, was ist da unterwegs? Ist das sinnvoll?
Betsch: Doch, das ist wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Social Listening ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um zu gucken, zum Beispiel mit dem 100.000-mal geklickten Bhakdi-Video. Welche Fragen haben die Leute? Und dann gibt es auch durchaus Handbücher von der WHO, wie mit so was umgegangen werden soll. Also wird das viel geteilt? Verbreitet sich das? Wird es von den Medien aufgegriffen?
Das sind alles so Hinweise, ob man sich tatsächlich dazu äußern sollte, weil man eben immer diese Balance finden muss zwischen, säe ich jetzt hier Falschinformationen, indem ich dazu Informationen bereitstelle? Oder ist es effektiv, zu sagen: "Leute, hört mal, das ist falsch". Und hier ist übrigens die richtige Information. Da gibt es durchaus auch Handbücher von der WHO, die da eingesetzt werden sollten.
Hennig: Wir haben auch schon über einfache Botschaften gesprochen, einfache Sprache. Meine Wahrnehmung von der Kampagne war teilweise, dass eigentlich hauptsächlich die Botschaft immer wieder repliziert wurde. "Impfen schützt", ohne eine genauere Konkretisierung oder eine Argumentation, was sich eigentlich genau dahinter verbirgt. Hat es also nicht genug Angebote in einfacher Sprache gegeben, die darüber hinausgehen? Weil das ist ja nicht gemeint mit einfacher Sprache, dass man nur sagt "Impfen schützt". Oder, Frau Jenny?
Jenny: Genau, das ist damit nicht gemeint, sondern dass man die Fakten, die man rüberbringen will oder diskutieren will, möglichst gut erklärt, und möglichst unkompliziert. Und mittlerweile bei Omikron, was so weitverbreitet ist, ist es aber nicht mehr so ein Problem. Aber, was ich lange als Problem wahrnahm: Ich hatte das Gefühl, die Leute glaubten, entweder habe ich die positiven und möglichen negativen Wirkungen vom Impfen oder nicht. Aber das war nicht die Alternative.
Die Alternative ist ja, sich irgendwann mit Covid zu infizieren. Und diesen Vergleich, vielleicht auch grafisch dargestellt zu vergleichen: Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das durch die Impfung habe? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich das durch die Infektion habe, die ja früher oder später kommen wird? Und da gibt es auch einfache Grafiken, die ganz häufig auch von den Medien verwendet werden, also zum Beispiel tausend Punkte. Und dann sind da mit Impfung drei rot für eine Entzündung und ohne Impfung 30.
Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber dass man auch so etwas so leicht visuell erfassbar macht. Okay, beim Impfen sind es ganz, ganz wenige, die das haben, bei der Covid-Erkrankung sind es ganz, ganz viele. So was hab ich einfach viel zu selten gesehen. Und da gibt’s, und das ist auch ein Punkt, der ist auch so schade, in Deutschland so gute Forschungsgruppen, die solche Dinge entwickeln. Nur dieser Übertrag auf "Zusammen gegen Corona" oder so hat leider nur sporadisch geklappt.
Unsicherheitskommunikation
Hennig: Jetzt gehört aber auch Transparenz und Ehrlichkeit zu Kommunikation dazu. Also es gibt viele Fragen. In der Pandemie gab es immer wieder Leute, die gefragt haben: Können Sie mir garantieren, dass ich zum Beispiel von der Impfung nicht folgendes bekomme? Und ehrliche Wissenschaft würde natürlich immer antworten: "Garantieren kann ich gar nichts". Und zwar sogar dann, wenn das Restrisiko im Promillebereich liegt. Wie kann man denn in einfacher Sprache solche Unsicherheiten kommunizieren? Wie ist das lösbar?
Jenny: Zum Thema Unsicherheitskommunikation weiß man generell ein bisschen weniger als zum Thema Risikokommunikation, also Kommunikation von Wahrscheinlichkeiten und Zahlen. Aber es ist auf jeden Fall gefährlich, Sicherheit zu implizieren. Ich glaube, es braucht in der Bevölkerung eine gewisse Risikokompetenz, die gefördert werden muss zur Akzeptanz, dass es eben im Leben eigentlich fast keine Garantien gibt. Aber dann muss man natürlich, wenn man sagt: "Okay, ich kann das jetzt nicht garantieren, aber es ist halt wirklich fast sicher, dass das zum Beispiel nicht eintreten wird", also wie sicher man sich ist, sozusagen möglichst rüberbringen. Oder auch wie selten denn so ein unerwünschtes Ereignis ist möglichst griffig zu erklären.
Unterschied zwischen politischer Kommunikation und Gesundheitskommunikation
Hennig: Jetzt haben wir das schon ein bisschen kleinteilig angeguckt, wenn man den Blick aufs große Ganze wirft und man die gesamte Impfkommunikation aus der Politik heraus subsumiert. Frau Betsch, steht da ein Grundprinzip dahinter, das vielleicht falsch verstanden wurde, weil das Vertrauen in Wissenschaft ja messbar relativ groß in der Pandemie gewesen ist?
Betsch: Ich glaube, wir haben in der Pandemie diese Sondersituation gehabt, dass Impfen ein Ausweg aus dieser Pandemie sein sollte. Und sich plötzlich politische Kommunikation mit Gesundheitskommunikation gemischt hat. Das war ja auch vorher in der Pandemie schon, da ging es eben um andere Themen wie Maske tragen oder so. Das wurde dann eben verordnet und es gab dann Lockdown und so weiter.
Aber mit dem Impfen ist es plötzlich ja noch stärker ein Gesundheitsthema, wo es auch Risiken gibt, die es abzuwägen gilt. Ich erinnere mal an die AstraZeneca-Geschichten, dass Nebenwirkungen sehr selten, aber schwerwiegender aufgetreten sind. Da musste man erst mal rausfinden, welche Bevölkerungsgruppe denn und so weiter. Also da gab es wirklich sensible Gesundheits- und Risikokommunikationsthemen, die plötzlich von Politikern kommuniziert werden mussten. Und das ist natürlich nicht deren Kerngebiet.
Politische Kommunikation hat ja eigentlich auch andere Ziele als Gesundheitskommunikation. Und so ging es, glaube ich, relativ häufig durcheinander: Ein Werben für die Impfung, wo vielleicht mit besonderer Emphase auch gesagt wurde "Das ist super, das ist sicher". Und wir sollen es alle machen.
Gesundheitskommunikation
Und auf der anderen Seite steht die Gesundheitskommunikation, die sagt: Das sind die Risiken der Erkrankung, das sind die Risiken der Impfung. Und das ist der Nutzen der Impfung. Wenn ihr euch impfen lasst, könnt ihr weniger erkranken. Das könnt ihr euch dadurch ersparen. Also das ist ein bisschen komplexer und kann aber natürlich, wenn es gut gemacht ist, die informierte Entscheidung erleichtern.
Wir haben in Deutschland eine freie Impfentscheidung. Und deswegen sollte jeder gut darüber informiert werden. Und dadurch, dass das so ein bisschen durcheinanderging, glaube ich, ist das einigen Leuten aufgestoßen. Am Anfang wussten wir noch nicht viel über die Sicherheit. Das hat sich dann relativ schnell verbessert. Oder die Wirksamkeit, die Effektivität wurde viel diskutiert. Wirksamkeit wogegen denn? Gegen schwere Erkrankung oder gegen Infektion oder Tod? Da gibt es große Unterschiede und große Unsicherheiten.
Da wurde so ein bisschen, sage ich mal, mit einem dicken Pinsel aufgetragen, wo man vielleicht ein bisschen differenzierter hätte kommunizieren können. Ich glaube, dass dadurch einiges verloren gegangen ist, weil wir in Deutschland eben nicht eine Struktur haben, eine Stelle, die diese Gesundheitskommunikation in ihrer Komplexität aber runtergebrochen erklärt. So, dass sie wirklich für jeden durch Filme, durch Infografiken zugänglich ist - wie Frau Jenny gerade erklärt hat. Dass es diese nicht gibt, hat glaube ich auch die politische Kommunikation erschwert, weil die Politiker dann eben etwas verkaufen mussten, was medizinisch sehr komplex ist. Und eigentlich auch keine politische Kommunikation, sondern Gesundheitskommunikation ist.
Hennig: Hat das auch mit Glaubwürdigkeit zu tun? Also dass die Politik, sagen wir mal das Gesundheitsministerium eigentlich der falsche Absender ist? Weil man es dann mehr als politische Werbung als wirklich einen Informationsservice für mich wahrnimmt?
Betsch: Das Vertrauen in die Regierung spielt auch bei der Impfbereitschaft eine Rolle. Es spielt bei der gesamten Maßnahmenakzeptanz eine Rolle. Und was wir gesehen haben, auch in den COSMO-Daten, ist, dass über die Zeit das Vertrauen in die Regierung gesunken ist. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die Regierung der Hauptkommunikator ist, dann gibt es über die Zeit immer mehr Leute, die ich verliere, weil die sagen: "Ach, die Regierung, der vertraue ich nicht mehr. Da höre ich nur noch mit einem halben Ohr oder gar nicht mehr zu". Und da passieren dann vielleicht andere Dinge. Die suchen dann selber, finden komische Webseiten oder verschwinden in Telegram-Gruppen.
Public Health-Institut
Deswegen ist es wichtig, einen anderen Absender zu haben, der nicht die Regierung ist, sondern ein Public-Health-Institut, wo die Wissenschaft wohnt und wo aus den Daten, aus der Evidenz heraus gut kommuniziert wird. Und da meine ich jetzt sowohl die medizinisch-virologische Evidenz als auch die Evidenz, die wir aus der Psychologie und Kommunikationswissenschaft, also Gesundheitskommunikation haben.
Hennig: Jetzt hat es, da haben Kollegen aus anderen Wissenschaftsredaktionen, von der Zeit zum Beispiel, vor ein paar Wochen auch schon darauf hingewiesen, mal eine sehr erfolgreiche Aufklärungskampagne gegeben, nämlich die AIDS-Aufklärungskampagne in den 90er-Jahren von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Frau Jenny, Sie haben ja in Ihrer Arbeit für das Robert Koch-Institut viel mit den Strukturen zu tun gehabt. Wäre das nicht ein Weg gewesen, den man hätte gehen können?
Jenny: Auf jeden Fall, das wäre ein Weg gewesen. Der wurde jetzt zur Pandemie aber nicht gegangen, anders als damals in der AIDS-Krise. Da wurde die Kommunikation doch sehr stark ans BMG gebunden oder von dort aus gemacht. Und natürlich kam da Zuarbeit von der BZgA, aber Absender war am Ende das BMG, teilweise auch das RKI.
Da gibt es dann noch mal Komplexitäten, weil das RKI eigentlich die Fachöffentlichkeit anspricht, die BZgA die allgemeine Öffentlichkeit. Aber das RKI hat in der Krise begonnen auch die Öffentlichkeit anzusprechen. Es war auch so ein bisschen die Stimme der Vernunft und auch der Wissenschaft auf eine positive Weise. Aber es wurde doch sehr, sehr vieles fast gehortet im BMG und für mein Verständnis auch zu wenig unkonventionellere Kommunikatoren mit eingebunden. Denn Vertrauen ist das eine.
Augenhöhe in der Kommunikation
Aber Augenhöhe ist auch ein wichtiges Thema. Und was es zum Beispiel in Berlin teilweise gab, war dann Impfkommunikation, zumindest Themensetzung von der Müllabfuhr, von der städtischen, also von der BSR, oder vom öffentlichen Verkehr, von der BVG. Und es gibt auch in einer Pandemie oder öffentlichen Krise Zeitpunkte, wo es einfach wichtig ist, dass ganz unterschiedliche Kommunikatoren und auch so ein bisschen mehr aus der Mitte der Gesellschaft heraus kommunizieren. Ich denke, da ging eigentlich noch viel mehr.
Hennig: Wie hat man das denn zum Beispiel in Dänemark gemacht, wo die Impfkampagne ja zumindest vor allem, was die Älteren angeht, sehr erfolgreich war? Auch wenn es da natürlich auch Impfskeptiker gegeben hat, wie überall?
Jenny: Frau Betsch hat es angesprochen. Man hat mehr vom Nutzer gedacht, da war es einfacher, sei es zum Beispiel auf der Website auf die Information zuzugreifen. Internationale Vergleiche sind aber häufig schwierig, weil sich zwischen Ländern ganz unterschiedliche Dinge unterscheiden können. Die Kommunikationsstrategie ist das eine. Vertrauen in Wissenschaft und Politik ist noch mal was anderes. Das soziale Vertrauen zwischen Bürgerinnen, das auch zu mehr Impfmotivation führen kann, weil man sich und auch andere schützt. Das sind so viele Faktoren, die sich unterscheiden, deswegen sind diese Vergleiche nicht ganz einfach.
Betsch: Auch was ganz Praktisches war dort anders. Man hat nämlich gesagt: Wir machen von oben nach unten, die Alten zuerst, die Jungen zuletzt nach Jahrgang. Man hat automatisch einen Impftermin in sein E-Mail-Postfach bekommen oder per SMS, man bekam den einfach zugeschickt. Also das, was wir vorhin schon besprochen haben.
Bei uns gab es komplizierte Impfrechner. Tageszeitungen haben dann gesagt, wo stehen Sie in der Reihe und wie viele Leute sind noch vor Ihnen? Das war da völlig egal, weil es war klar, wenn mein Jahrgang dran ist, dann kriege ich eine E-Mail, ich muss einfach warten und dann gehe ich dahin. Also es war möglichst einfach gemacht.
Hennig: Es liegt aber auch an der Kommunikation, auch wenn die Grundbedingungen anders sind. In Dänemark hat ja auch soziale Arbeit gesellschaftlich einen anderen Stellenwert als zum Beispiel hier. Aber hat in der Kommunikation die Ehrlichkeit und die Transparenz anders funktioniert als in Deutschland? Können Sie das von hier aus wahrnehmen?
Betsch: Das kann ich nicht sehr gut beurteilen. Ich erinnere mich nur an eine Sache. Da ging es um die Frage, ob AstraZeneca weiter im Impfprogramm bleibt oder nicht. Da hat die Regierung die dortige Stiko, die Impfkommission gebeten, das noch mal zu bewerten und hat dann abgewartet, was die sagen und danach entschieden. Und das finde ich eigentlich einen sehr positiven Umgang, dass die Regierung sagt: "Wir haben hier ein unabhängiges Gremium. Bitte befasst euch damit. Wir warten auf eure Entscheidung und dann setzen wir das um".
Das respektiert die Expertise und setzt dann auch noch mal ein Ausrufezeichen des Vertrauens hinter diese Aussage. Das ist in Deutschland durchaus ab und zu mal anders gelaufen. Da kann man nie kausal sagen, was jetzt hier woran irgendwie gelegen hat und an welchen Faktoren. Frau Jenny hat schon gesagt, es ist unglaublich komplex und unterscheidet sich. Aber das sind so Dinge, die einem vielleicht auch im Gedächtnis bleiben, wenn man das so vergleicht.
Kommunikation der Stiko
Hennig: Beim Beispiel Stiko ist es auch nötig, als vertrauensbildende Maßnahme darüber zu kommunizieren, wann man kommuniziert? Ich erinnere mich, dass zum Beispiel bei der Frage, ob es eine Impfempfehlung für Kinder gibt, viele Eltern wochenlang gewartet haben und gar nicht wussten: Wann kommt eine? Wann kommt zumindest die Nachricht, es wird keine kommen? Hat das in Deutschland auch gefehlt? Oder ist es sozusagen nur so eine anekdotische Wahrnehmung?
Betsch: Die Stiko genießt in Deutschland hohes Vertrauen. Und wir haben auch in COSMO gefunden, dass die Eltern sagen: Das ist für mich total relevant, was die Stiko sagt. Wir haben dann allerdings gesehen, dass das nicht mit der Impfentscheidung zusammenhing, ob sie das machen wollen oder nicht. Wir haben aber deutlich gesehen: Als die Stiko nachher die Empfehlung rausgegeben hatte, dass in den Altersgruppen die Durchimpfungsrate nochmal gestiegen ist. Also das ist für die Eltern schon relevant. Und je mehr Sicherheit man da hat und da man muss auch sagen, je weniger Spekulationsspielraum für die Medien man dadurch lässt, umso besser.
Vertrauensverlust in die Regierung
Hennig: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der allgemeinen Krisenkommunikation und auch der Frage nach der Akzeptanz politischer Maßnahmen. Frau Betsch, wenn wir noch mal auf die COSMO-Studie gucken, Sie haben das vorhin schon angedeutet, das Vertrauen in die Regierung ist immer weiter gesunken. Am Anfang war aber auch international eine allgemeine Wahrnehmung: In Deutschland läuft es total gut. Die kommen viel besser durch die Pandemie. Und dann irgendwann, ich meine so im Frühjahr 2021, ist das so ein bisschen gekippt. Was ist da passiert? Was können Sie da aus den COSMO-Daten ablesen?
Betsch: Das war so zwischen der zweiten und dritten Welle. Da haben wir einen deutlichen Vertrauensverlust gesehen. Der fand insbesondere unter den Personen statt, die eigentlich die Maßnahmen befürwortet haben. Da war ja dieser lange Lockdown und dann wurde geöffnet. Das wurde im Narrativ der Politik häufig begründet mit: Die Leute sind Pandemie-müde und wir müssen aufmachen. Und das stimmte auch. Die Leute waren Pandemie-müde. Aber diese Daten wurden eben nicht im Gesamtkontext interpretiert.
Die Leute haben trotzdem noch ein hohes Risiko wahrgenommen, denn das war noch in der Delta-Zeit. Da sind immer noch viele Leute gestorben, weil wir viele Fälle hatten. Und da fühlten die Menschen sich nicht richtig geschützt. Dadurch ist, glaube ich, viel Vertrauen verloren gegangen und es fand zunehmend eine Politisierung der Maßnahmen statt. Also man sprach politisch nicht mehr mit einer Stimme. Man hatte verschiedene Wahlkämpfe an verschiedenen Orten.
Dann kam auch irgendwann der Bundestagswahlkampf, da hat man das Thema relativ rausgehalten, was ich wirklich gut finde. Aber es gab genug Landtagswahlen. Dann haben die Parteien sich natürlich schon auch noch mal stärker positioniert, welche Maßnahmen jetzt wie richtig sind. Ich glaube, diese Gesamtgemengelage, auch hier kann man nicht sagen, was jetzt die alleinige oder wichtigste Ursache ist, aber insgesamt konnte man in der Zeit dieses Muster beobachten.
Hennig: Ist es auch eine Frage der Narrative? Wir hatten am Anfang diese Bilder aus Bergamo. Da war Angst noch so ein entscheidender Motor, auch persönliche Angst. Und Angst nutzt sich ja aber auch ab. Hat da was gefehlt, dass man sich überlegt hat, unter welche Überschrift stellen wir das Ganze oder von wo aus denken wir denn jetzt die Kommunikation der Maßnahmen?
Jenny: Ja, genau. Angst kann initiativ eine große Wirkung haben. Ich glaube, die Bilder aus Bergamo spielten eine wichtige Rolle. Aber auch diese Ansprache zu Beginn der Pandemie im März von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die auch sehr persönlich war, aber auch sehr ernst. Ich glaube, das hatte einen sehr, sehr großen Effekt. Aber Angst lässt sich halt über die Zeit nicht aufrechterhalten. Der Mensch gewöhnt sich an vieles. Das ist das eine.
Angstbotschaften
Und man fühlt sich vielleicht auch irgendwann so ein bisschen veräppelt, wenn immer diese Angstbotschaften kommen, und man möchte lieber Kommunikation auf Augenhöhe. Und Angst kann auch lähmen. Also, dass ich mich zwar vorm Virus fürchte, aber deswegen weiß ich ja jetzt noch nicht, was zu tun ist. Und vielleicht wird meine Selbstwirksamkeit durch diese Angst sogar geschwächt.
Und das heißt, viel wichtiger ist, dass man auf das Risiko aufmerksam macht und das man möglichst zeitgleich auch sagt: "Okay. Und was können wir jetzt hier tun, damit das besser wird? Und so kann es besser werden. Und das machen wir jetzt alle". Das ist so zwar aufmerksam machen auf das Risiko, aber dann schnell ins Handeln und in die Selbstwirksamkeit rein und einfach auch Perspektive geben, dass es besser werden kann und wie. Und das tun wir jetzt zusammen.
Corona-Maßnahmen der Neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern
Hennig: Ein oft genanntes Beispiel im Zusammenhang, wie kommuniziert man die besonders harten Maßnahmen gut, war ja die neuseeländische Regierungschefin, Jacinda Ardern. Sie hat die direkte Ansprache gewählt, aber auch ganz ehrlich gesagt: "Leute, das wird jetzt erst mal nicht schön". Wie wichtig ist so eine Personalisierung, aber auch die Empathie, die persönliche Nähe zur Bevölkerung, die da politisch stattgefunden hat - mit dem, was Sie aus der Forschung tatsächlich wissen?
Betsch: Da gibt es einen ganz wunderbaren wissenschaftlichen Artikel über die ersten 50 Pressekonferenzen von ihr und da werden diese täglichen Briefings als die Lieblingsfernsehsendung der Neuseeländer beschrieben. Also das hatte unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und sie hat es geschafft über Metaphern, über Sprache etwas Passives wie Zuhausebleiben dazu zu machen, dass die Neuseeländer aktiv miteinander Leben geschützt haben.
Sie hat aus dem Sport verschiedene Metaphern genutzt, um das zu Hause Rumsitzen, Nichtstun, zu was aktivem Positiven zu wenden. Und diese Briefings waren einfach mehr als nur Wissenstransfer oder der Bericht von neuen Zahlen. Sie hat sehr stark an die gemeinsamen Werte appelliert, die sie haben. Das ist eine extrem diverse Gesellschaft. Und sie hat auch sehr klar angesprochen, wie unterschiedlich diese diversen Gruppen diese Situation erleben und hat es im Prinzip genutzt, mit der Bevölkerung zu reden, anstatt nur zur Bevölkerung.
Sie hat es dadurch geschafft, dass eben diese Presse-Briefings zur Lieblingsfernsehsendung der Neuseeländer wurden. Und das finde ich im Ganzen einen bewundernswerten Ansatz. So eine Pandemie ist eine sehr lange Durststrecke, sie hatten dann auch einen ganz guten Impf-Uptake, der ist jetzt am Ende auch nicht perfekt geworden, aber letztendlich zeigt das, dass eine solche Strategie eben auch ein so diverses und kulturell unterschiedliches Land gut durch so eine Krise bringt.
Pandemie-Kommunikation in Dänemark
Hennig: Sie haben es eben auch schon angesprochen, man muss eigentlich wissen, wo es hingeht, also man muss auch aus den anstrengenden Maßnahmen heraus so eine Zielvorgabe machen. Noch mal beim Beispiel Dänemark, da gibt es ein Paper, das so eine schöne Überschrift trägt von dem dänischen Politologen Michael Bang Petersen.
Der hat zusammen mit dem Komplexitätsforscher Sune Lehmann und anderen untersucht, wie die Akzeptanz der Maßnahmen ist und verschiedene Szenarien zugrundegelegt. Das Paper heißt "Communicate hope to motivate Public during the Covid-19 pandemic", also Hoffnung kommunizieren, um zu motivieren. Was kann man aus diesem Forschungsbeispiel ableiten? Können Sie uns das ein bisschen näherbringen, Frau Betsch?
Betsch: Ja, Frau Jenny hat gerade schon erklärt, dass so eine Bedrohungswahrnehmung eigentlich wichtig ist. Wenn wir uns nicht bedroht fühlen, dann wollen wir uns auch nicht schützen. Aber dass man es eben damit auch sehr überspannen kann. Und was wir in Deutschland gesehen haben, sind häufig so steigende Kurven, die so ein Bedrohungsszenario aufgemacht haben. Wie wird das unter bestimmten Bedingungen projiziert, wenn wir Lockdown haben oder wenn wir ganz viel impfen? Wie verändert sich das?
Und die Wissenschaftler aus Dänemark haben in ihrer Studie verglichen, was passiert, wenn man jetzt nur diesen Anstieg zeigt oder wenn man ganze Kurven zeigt. Wir wissen jetzt schon aus der Erfahrung, eine Welle steigt an, aber sie fällt auch wieder ab einem gewissen Punkt. Wenn nämlich die Maßnahmen greifen und das Virus sich nicht mehr weiterverbreiten kann. Entweder, weil genug Menschen geimpft sind oder weil wir alle keine Kontakte mehr haben.
Und was sie gezeigt haben, ist, dass diese Kurven, wo man sieht: "Okay, es steigt jetzt noch ein Weilchen, aber dann, wenn wir diese verschärften Maßnahmen haben, dann fallen sie auch sehr schnell wieder, diese Fallzahlen". Das führt erst mal zu mehr Hoffnung unter den Leuten. Und da kann man sagen: "Na gut, Hoffnung ist uns vielleicht in dem Sinne egal, Hauptsache, die Leute halten sich dran". Das passiert aber auch.
Die sehen die Maßnahmen dann stärker ein und gehen mit mehr Selbstwirksamkeit und quasi positiver in diese Verschärfung der Maßnahmen und halten das Risiko für größer und sehen stärker ein, dass diese Maßnahmen ergriffen werden sollen. Und das fand ich eigentlich einen sehr guten Ansatz. Das, was Frau Jenny mit Selbstwirksamkeit bezeichnet hat: Wir wollen im Prinzip den Leuten etwas an die Hand geben. Wenn wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, dann verändert sich auch was in der Umwelt. Und wenn man das eben gut kommuniziert, dann kann das dazu führen, dass wir eben auch mehr Compliance haben, dass die Leute sich dann auch tatsächlich mehr an die Dinge halten.
Hennig: In Deutschland hat man das so ähnlich gemacht, aber eben nicht genauso. Man hat manchmal ein Datum genannt. Die Politiker haben dann ab und zu gesagt: "Bis dann und dann gibt es die Maßnahmen und dann gibt es auch keinen Lockdown mehr". War das der gedankliche Fehler, dass man eben keine Szenarien gezeigt hat und dass man sich auf Dinge festgelegt hat, auf die man sich nicht festlegen konnte?
Betsch: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Jetzt kann man sagen, das war ein Fehler. Ich denke, was wir in COSMO gesehen haben, ist, dass die Belastung natürlich hoch war. Wir haben verschiedene Szenarien verglichen und haben gefragt, wie würdest du dich belastet fühlen, wie würdest du es begrüßen, wenn es eine solche Regelung geben würde? Entweder wenn die Maßnahmen an einem bestimmten Tag enden würden oder wenn sie bei einer bestimmten Fallzahl enden würden?
Das war dann noch so das Maß aller Dinge. Und da haben wir immer wieder gesehen, dass die Fallzahl, ab der dann die Maßnahmen nicht mehr gelten, dass das eigentlich immer am besten abgeschnitten hat, also dass man schon die Menschen mitnehmen kann oder sollte zu einem inhaltlichen Ziel, wo sie eben, wenn sie informiert sind, hin wollen. Und dann: Hier ist die Regel, die es euch einfach macht, das Verhalten zu zeigen, was uns zu diesem Ziel bringt. Und dann fallen die Maßnahmen wieder.
Dass sozusagen die ganze Kurve mitnimmt, dass hat eigentlich am positivsten abgeschnitten in der Bewertung. Und zusammen mit der dänischen Studie kann man noch sagen, dass die Menschen eben sehr wohl auch die positive Emotion hatten, die man damit verbindet, helfen zu können.
Präventionsparadoxon
Hennig: Kann das auch das Problem des Präventionsparadoxon lösen? Also wenn die Maßnahmen wirken, ist der mögliche Schaden dann natürlich wieder unsichtbar geworden und die Reaktion ist dann oft: "War ja alles gar nicht so schlimm, man hätte die Maßnahmen nicht gebraucht". Gibt es da auch Erkenntnisse zu, Frau Jenny, aus der Psychologie? Macht es das auch im Nachhinein sichtbarer für die Menschen, dass sie nachvollziehen können: Wir haben ja gesehen, so und so lange haben wir durchgehalten und die Fallzahlen gingen dann sichtbar daran runter?
Jenny: Ja, ich denke schon, dass das hilft, ganz klar zu illustrieren, was man inhaltlich erreicht hat, zum Beispiel die niedrigeren Zahlen und dass die vielleicht zu sinken begonnen haben, als bestimmte Maßnahmen ergriffen wurden. Ich glaube, beim Präventionsparadox wäre es hilfreich, das auch mal gut zu erklären.
Das ist ein generelles Problem der Prävention und dem öffentlichen Gesundheitswesen, dass es häufig so aussieht, als wäre Prävention nicht wichtig gewesen, weil danach eben nichts eintritt. Aber es wäre ja ohne die Maßnahmen höchstwahrscheinlich eingetroffen und dass man das mal ganz gut erklärt. Ich glaube, das wäre wichtig, damit man die Leute auch so ein bisschen gegen diese Wahrnehmung impft, dass das ja alles irgendwie übertrieben war.
Hennig: So ähnlich war es ja auch beim exponentiellen Wachstum. Also da war etwas noch nicht sichtbar. Und weil man das aber so schwer intuitiv erfassen kann, denkt dann der Laie sehr lang: Geht doch gut, die Zahlen sind niedrig. Und dann plötzlich kippt so eine Entwicklung in ganz wenigen Tagen. Wie kann man da kommunizieren, um die Allgemeinbevölkerung ein bisschen mehr zu befähigen, ein Risikobewusstsein zu haben und zu vermitteln, warum kann das so schnell gehen?
Jenny: Ich glaube, hier wären Grafiken oder Animationen hilfreich. Die gibt es ja auch. In denen man einfach zeigt, wie schnell etwas wächst, wenn es linear wächst und was es bedeutet, vielleicht auch mit Punkten. Und dann werden immer mehr rot oder so. Das zeigt, wie schnell es gehen kann, wenn etwas exponentiell wächst. Und das ist ja auch nicht nur für Covid ein wichtiges Thema.
Sich exponentiell verschlimmernde Fehler oder so sind generell ein Thema und das wird auch bei der Klimakommunikation wichtig. Ich glaube, es gibt einfach auch so Grundprinzipien, wissenschaftliche Grundprinzipien, wo wir gut daran tun würden, die immer mal wieder gut zu erklären.
Lehren für die zukünftige Kommunikation
Hennig: Wenn wir jetzt versuchen, nach vorne zu gucken: Sie haben schon so ein paar Sachen angesprochen, dass man Menschen vielleicht ein bisschen imprägnieren kann, vorbereiten kann auf Szenarien. Wenn wir gucken, was kann und was muss man aus der Pandemie lernen? Für andere Krisen, für die Kommunikation zur Klimakrise, auch allgemein für die Gesundheitskommunikation.
Dann gibt es da ja auch noch diesen sozioökonomischen Aspekt, also so eine Schieflage, das weiß die Medizinsoziologie schon lange, dass Menschen mit schwächerem Einkommen oft stärker von Gesundheitsrisiken betroffen sind. Was für Strukturen braucht es, um dieses Grundproblem, das sich in der Pandemie gezeigt hat, sowohl auf der Informationsebene als auch bei den tatsächlichen Auswirkungen zu beheben? Was muss sich da grundlegend ändern?
Betsch: Ich glaube, in Bezug auf die Pandemie ist erst mal wichtig, dass wir umdenken. Denn es wurde hauptsächlich immer auf das Virus fokussiert. Natürlich ist es wichtig, herauszufinden, wie verbreitet es sich und wie verhält es sich und welche Varianten gibt es und so weiter. Das ist natürlich total wichtig und zentral in den Maßnahmen und in der Kommunikation, aber der Wirt des Virus ist auch extrem wichtig.
Und ich würde mir wünschen, dass wir stärker den Menschen als den Wirt des Virus in den Mittelpunkt nehmen. Alena Buyx hat mal gesagt, wenn man auf eine Tagung geht, dann sagt immer jeder in seinen medizinischen Vorträgen, wie wichtig Kommunikation ist und dann geht das Tagesprogramm weiter. Dann ist Samstagnachmittag und alle fahren nach Hause. Und dann kommt der Block, wo die Kommunikation kommt.
Und so ist es zum Beispiel auch im Pandemieplan, der vor dieser Pandemie bestand und der jetzt verändert wurde. Aber was man quasi als Erstes aufgemacht hat, als die Pandemie vor der Tür stand, ist Kommunikation. Ich weiß nicht, ob es das letzte Kapitel ist, aber sehr weit hinten. Und ich glaube, wir müssen umdenken und den Menschen zentral in den Fokus nehmen. Das gilt für die Pandemie, das gilt aber auch für die Klimakrise.
Verhalten beeinflusst Krise
Letztendlich treiben wir das Problem mit unserem Verhalten. Wenn wir viele Kontakte haben, dann verbreitet sich das Virus. Und da muss umgedacht werden, der Mensch muss verstanden werden, denn sonst kann man eben Verhalten nicht verändern. Und wenn man das jetzt in die Strukturen übersetzt, kann man sagen, die Krisenstäbe, die es gibt, die brauchen jemanden, der sich mit menschlichem Verhalten auskennt. Nicht nur Kommunikation, das ist irgendwie ein Teil davon.
Jetzt wird immer gesagt, Kommunikation ist so wichtig, wir müssen die Kommunikation verbessern. Aber wenn Sie Regeln haben, die seltsam sind, die kein Mensch versteht oder die hier anders sind als woanders, im Nachbarbundesland zum Beispiel, dann verstehen Menschen das nicht mehr und wollen sich dann vielleicht nicht mehr dran halten.
Das heißt, auch schon beim Schaffen der Umgebungsbedingungen, der Regeln ist es wichtig, an das Verhalten und die Wahrnehmung der Menschen zu denken. Wir brauchen in diesen Krisenstäben Leute, die sich mit Verhalten, mit Kommunikation auskennen, die das immer voransetzen. Denn, wenn wir tolle neue Regeln machen, weil wir was tolles Neues über das Virus rausgefunden haben, kann so eine Regel nur so gut sein.
Einmal natürlich, wie effektiv sie zum Beispiel die Ausbreitung des Virus verhindert, aber eben auch, wie gut der Mensch sich am Ende daran hält. Das sehen wir beim Impfen. Wir können die tollste Impfung haben. Wenn die Leute es nicht tun, bringt sie nichts. Und das muss immer von Anfang an mitgedacht werden.
Kommunikation mitdenken
Und das, glaube ich, ist ein großer Fehler in der Pandemieplanung oder auch Klimakrise, dass wir das nicht von Anfang an stark genug mitdenken. Und dafür brauchen wir Strukturen, die wissenschaftsbasiert kommunizieren, also wo die Inhalte natürlich wissenschaftlich korrekt sein müssen, aber die eben auch Befunde aus der Psychologie, Kommunikationswissenschaft, Gesundheitskommunikationsforschung benutzen, um diese Inhalte zu kommunizieren.
Und zwar nicht nur in dem Sinne, wie nach diesem Knowledge-Deficit-Model, also die Menschen müssen nur das Richtige wissen, und dann machen sie auch das Richtige. Das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Also die quasi die gesamte Palette benutzen. Erst mal so die Strukturen schaffen, dass das gewünschte Verhalten einfach ist und die Leute dabei in ihrer Selbstwirksamkeit unterstützt werden.
Sie müssen also wissen, warum sollen sie das tun und wie können sie das einfach tun, dass ihnen erklärt wird, warum sie etwas tun sollen und dass das eben möglichst einheitlich und wenig verwirrend ist. Und natürlich verständlich. Das wären, sagen wir mal, die wesentlichen Wünsche. Und dafür haben wir im Moment keine Strukturen.
Da haben wir ja auch aus dem Expertenrat die fünfte Stellungnahme zur Kommunikation verfasst, wo wir das noch mal ein bisschen aufdröseln, dass es eine solche Struktur bräuchte. Und wir weisen da sehr explizit auch darauf hin, dass es eben auch noch andere Krisen gibt, wie die Klimakrise, wo eine solche Kommunikation, die nach diesen Prinzipien verläuft, eben zentral wichtig ist.
Verhaltensentscheidungen
Hennig: Frau Jenny, Verhaltensentscheidungen, da gibt es einige Erkenntnisse in der Verhaltenswissenschaft. Und gerade, wenn man versucht, sie über Strukturen dahin zu bringen, wo sie dann tatsächlich Teil der Entscheidung werden.
Nudging
Viele kennen zum Beispiel das Nudging. Das hat aber ein bisschen ein schlechteres Image, weil viele das als Manipulation wahrnehmen. Also das zum Beispiel im Supermarkt die teuren Dinge auf Augenhöhe einsortiert werden und die günstigen unten, um die Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Es gibt aber auch noch mehr Strategien, die man aus der Verhaltenswissenschaft kennt. Was kann man noch tun, gerade, um den Leuten das Gefühl zu geben, ich kann Entscheidungen aus mir heraus trotzdem noch tun?
Jenny: Beim Nudging geht es ja häufig darum, die Umwelt umzugestalten, um dann Leute in eine bestimmte Verhaltensrichtung zu bringen und dass man, das ist das simple Beispiel im Supermarkt, dass die gesunden Lebensmittel zugänglicher sind als die ungesunden. Das Gegenteil davon, wie momentan Supermärkte aufgebaut sind, besonders an der Kasse.
Boosting-Konzepte
Und dann gibt es aber auch Boosting-Konzepte. Die haben immer das Ziel, die Fähigkeiten des Einzelnen zu stärken, also Leute dazu zu bringen, sich selber zum Beispiel zum erwünschten Gesundheitsverhalten zu bringen. Also beispielsweise, wie Sie selber zu Hause Ihre Küche so organisieren, dass Sie gesünder essen können.
Und die zwei Ansätze können sich auch ergänzen. Ich will auch gar nicht das eine verteufeln, weil ich glaube, es ist immer wichtig, auch so einen Policy-Mix zu haben oder einfach unterschiedliche Dinge machen zu können, so eine Toolbox. Aber ein ethisch positiver Aspekt beim Boosting ist, ich kann nicht Leute manipulieren, denn ich brauche immer die Motivation von denen. Die verstehen dann was und sind dann vielleicht motiviert, was zu verändern.
Und ich kann die nicht so blind irgendwo hinführen. Das ist eine positive Seite davon, die aber auch eine negative Seite sein kann. Und ich brauche auch die Aufmerksamkeit der Leute und die Motivation. Aber es ist natürlich auch positiv, auch weil häufig die Effekte von Boosting-Maßnahmen längerfristig sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Nudging im Supermarkt das alles wieder umstelle und dann wieder die Süßigkeiten im Vordergrund stehen, dann gehen die Leute vielleicht schnell wieder dazu über, die dann auch bevorzugt zu kaufen.
Aber wenn ich selber verstanden habe, wie muss ich mir zu Hause eine Küche einrichten oder so, dann ist das ja auch was längerfristiges. Und da ist es dann nicht so, dass einfache Änderungen in der Umwelt mich dann wieder zum alten Verhalten führen. Es gibt einfach so viele Vorteile von diesen Boosting-Methoden und auch viele Methoden, die man im Gesundheitsbereich oder auch im Klimabereich anwenden kann, damit sich die Leute zum Beispiel auch gute Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten, gesund für sich selber oder gesund für den Planeten angewöhnen können und auch einfach aktiver sind. Das ist ein bisschen wie diese Philosophie der Gesundheitskommunikation, dass das eben was auf Augenhöhe ist.
Hennig: Also ein bisschen mehr informieren als lenken, sodass die Information einsickert und dann darüber auch mein Verhalten verändert.
Jenny: Genau. Informieren, schulen oder auch die Leute dazu bringen, sich Dinge anzueignen, Kompetenzen zu stärken, beispielsweise auch in der digitalen Umwelt die Leute dazu zu bringen, eher reißerische Information mehr zu hinterfragen, mehr lateral zu lesen, zu gucken: Ich habe hier eine Information, aber von wem kommt die eigentlich? Was schreiben andere über diese Autoren oder über diese Webseite?
Das sind alles Tricks, die brauchen erst einmal die Aufmerksamkeit der Leute und die Motivation, können dann aber auch wirklich effektiv sein, dass die Leute zum Beispiel die Falschinformation eher erkennen oder zumindest reißerische Information eher erkennen. Da gibt es aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen Boosts, die angewendet werden können.
Mehr Wissenschaftstransfer und Wissenschaftskommunikation
Hennig: Wenn man Ihnen beiden zuhört, hat man schon den Eindruck, in der Psychologie, in der Sozialforschung, der Verhaltensforschung, in der Kommunikationswissenschaft, da ist man eigentlich schon ziemlich weit und weiß schon wahnsinnig viel. Und trotzdem kommt das irgendwie nicht so richtig bei den politischen Entscheidern an.
Frau Betsch, Sie haben eben gesagt, Sie sitzen jetzt auch im Expertenrat. Krisenstäbe sind natürlich so ein Ansatzpunkt, dass man die Fachleute da reinsetzt. Aber was für Strukturen braucht es noch, um gleich bei der Planung von langfristigen Policies diese Erkenntnisse mit einzubeziehen? Also ich sage mal, das wirkt alles ein bisschen, als wenn die deutsche Impfkampagne eher nach gesundem Menschenverstand geplant wurde, einfache Botschaften und die Fachleute eben zu wenig gefragt wurden. Was für Strukturen braucht man noch so rein organisatorisch?
Betsch: Ich glaube, wenn man mal so vor sich hin träumen sollte, wäre es natürlich toll, man hätte ein großes Public-Health-Institut, wo die Daten zusammenlaufen und wo Experten sitzen, die wissen, was sie damit machen und wie sie die nach außen kommunizieren. Da braucht es dann einfach diese Expertise, die psychologische, die kommunikationswissenschaftliche, aber eben im Konzert mit den anderen. Und man kann sich jetzt natürlich hinsetzen und sagen: "Ach, wir Psychologen, wir Kommunikationswissenschaftler, wir werden so wenig gefragt".
Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen: Wir können natürlich auch aktiv nach draußen gehen. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel Wissenschaftstransfer, wie viel Wissenschaftskommunikation betreibt man selber? Das ist unglaublich aufwendig. Sie hatten Herrn Drosten in seinem tollen Podcast mit Ihnen, das ist ja ein Paradebeispiel für Wissenschaftskommunikation, wo jeder Wissenschaftler nur mit großer Bewunderung und Ehrfurcht eigentlich, das ist vielleicht besser ausgedrückt, draufguckt und sagt: "Wahnsinn, wie viel Zeit er da investiert".
Und Liebe zum Detail, weil das wirklich viel Arbeit ist. Aber dann wird es auch gehört. Also ich glaube, es braucht immer beides, die Awareness bei der Politik, aber eben auch die Bereitschaft der Wissenschaftler, sich einzubringen. Und ich glaube, da braucht es schon auf beiden Seiten noch mehr. Wir haben jetzt zwei Psychologen im Expertenrat. Das finde ich jetzt schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und das wird vielleicht einfach auch weiter Schule machen, hoffe ich, dass sich das in weitere Themenbereiche vorzieht, dass auch diese Art der Expertise wertgeschätzt wird.
Aber ich würde eben auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft sagen: "Einfach nur Paper schreiben und die vielleicht noch mal twittern, das reicht einfach nicht, im Sinne von: Dann wird man auch gehört". Denn es gibt so viele Leute, die sich an die Politiker wenden mit Brandbriefen und weiß ich nicht was für E-Mails. Wir bekommen jetzt, seit wir uns da öffentlich äußern oder im Expertenrat sind, auch diese E-Mails, sind wir oft im CC. Das ist irre, was Leute an die Politiker herantragen. Und das geht natürlich unter, wenn man als Wissenschaftler, der eine Studie irgendwie wichtig findet für Inhalte der Politiker und die dann mal twittert oder irgendwohin schickt. Man muss sich auch in den Dialog werfen und den auch einfach selber suchen.
Appell an Kolleginnen und Kollegen
Also das kann vielleicht jetzt als Appell an die Kolleginnen und Kollegen verstanden werden, sich da auch stärker zu engagieren. Denn wir müssen unsere Wissenschaft auch ernst nehmen, was sie tun kann und wo sie helfen kann. Auf der anderen Seite denke ich, haben wir in Deutschland ein großes Implementationsproblem. Wir haben wirklich gute Leute, gute Arbeitsgruppen. Es gibt noch und nöcher irgendwelche WHO-Guidance, die auf der Basis von internationalen Befunden sagen, wie geht man mit Falschinformationen um und so weiter. So was muss dann aber auch angewandt und genutzt werden.
Wir müssen uns aufeinander zubewegen, in den Dialog kommen und es muss mehr Bewusstsein geben, dass man Dinge auch systematisch verstehen kann. Nur, weil jeder jeden Tag kommuniziert, heißt es nicht, dass der gesunde Menschenverstand da reicht, um es gut zu machen, auf so einer Bevölkerungsebene. Und da gibt es viele Befunde, die wir systematisch untersuchen, wie man es tun sollte und was vielleicht besser funktioniert, was schlechter funktioniert. Und dieses Wissen zu nutzen, das wäre ja auch eine sinnvolle Nutzung von Ressourcen. Wir Wissenschaftler arbeiten den gesamten Tag auf der Basis von Steuergeldern, um dieses Wissen zu schaffen. Und es wäre doch schön, wenn es auch für diese Dinge mehr genutzt würde.
Hennig: Auch die Beobachtung und Analyse der Pandemiekommunikation kann da ja wieder neue Befunde liefern. Frau Jenny, bei der Klimakrise gibt es ja gerade ein Problem mit Ermüdungserscheinungen, weil man kennt längst die Krisenszenarien als Verbraucher. Gibt es da irgendwas, was Sie sich strategisch gesehen aus der Corona-Krise abgucken können, wo Sie sagen: "Da haben wir aus der Wissenschaft heraus tatsächlich was gelernt, was wir mitnehmen können"?
Jenny: Ich denke, das Strukturproblem und Implementationsproblem, was Frau Betsch angesprochen hat, das besteht ja auch da. Wenn wir jetzt ans Gesundheitsinstitut denken, das gebaut werden soll und wo meine starke Hoffnung ist, dass da Kommunikation als zentraler Baustein aufgebaut wird, dann brauchen wir eine gute Wissenschaftskommunikation auch im Bereich Klima, eine gute Klimakommunikation.
Da gibt‘s Spieler, die beispielsweise eher so stiftungsbasiert sind und die das machen und auch sehr gut machen. Aber auch auf offizieller Seite brauchen wir das Bewusstsein und brauchen auch Fähigkeiten, sprich: Leute, die das gut machen, die gut Klima kommunizieren. Die großen Klimaforschungsinstitutionen haben auch eigentlich selten wirklich breit aufgebaute Kommunikationsabteilungen, die dann eben erforschen, welche Maßnahmen gut funktionieren. Das heißt, auch da an verschiedensten Stellen strukturelle Lücken, die wir füllen müssen und wo wir einfach eine Kommunikationskraft aufbauen müssen. Damit wir einfach an wichtigen Stellen gute Leute haben, die das machen.
Frage der Ressourcen
Hennig: Ist das auch eine Ressourcenfrage? Sie haben ja auch Erfahrung im Robert Koch-Institut gesammelt, also in der Pandemie mit Krisenkommunikation, an der direkten Stelle sozusagen.
Jenny: Ja und nein. Ressourcen im Sinne von sehr guten Leuten natürlich. Das ist in der Tat nicht so trivial, es gibt einfach zu wenig Nachwuchs, der in diese Richtung ausgebildet wird. Anders als komplexe technische Bereiche beispielsweise ist die Kommunikation abseits von teuren Werbeflächen, wo die Sachen dann hin müssen ansonsten in der Entwicklung nicht so eine teure Sache.
Also das Geld, das man braucht, wird schnell wieder reingeholt, wenn dann zum Beispiel eine Pandemie viel effizienter bekämpft werden kann oder andere Dinge effizienter gestaltet werden können. Also es ist eigentlich viel mehr eine Sache des Verständnisses und des Willens der verschiedenen Institutionen oder der Politik, das umzusetzen, und dann natürlich auch der Wissenschaftlerinnen, nach draußen zu gehen und zu kommunizieren, auch im Klimabereich.
Kommunikation als professionelle Begleitung
Und da würde ich auch sehr gerne an Unis oder Umweltforschungsinstitutionen nicht nur die Kommunikationsabteilung sehen, sondern auch Begleitung für Wissenschaftler*innen, die rausgehen. Nicht jede Wissenschaftler*in ist geborener Kommunikator. Muss auch nicht so sein. Und es gibt ja schon Tücken in der Wissenschaftskommunikation, gerade im Bereich Klimaforschung. Dass man auch vielleicht angegriffen wird oder dass man in eine gewisse Richtung gedrängt wird in Talkshow oder so was, da braucht es auch professionelle Begleitung der Wissenschaftler*innen, dass die auch einfach professioneller und in gewissem Sinne geschützter agieren können.
Hennig: Jetzt haben wir einen großen Ausblick gemacht. Ich würde ganz zum Schluss gern noch einmal zurückkehren zu unserem konkreten Thema, zur Pandemiesituation und dem Ausblick auf die Wegstrecke, die wir da noch vor uns haben. Auch wenn viele das Gefühl haben, es ist schon vorbei. Für den Moment sieht es ja ganz gut aus. Aber wir wissen nicht, was im Herbst kommt.
Blick auf den Herbst und die Impfquote
Und dann könnte die Impfquote auch gesamtgesellschaftlich wieder wichtig werden mit Blick auf die Krankenhäuser. Wenn man auf die Erkenntnisse aus der letzten COSMO-Befragung guckt, dann kann man den Eindruck gewinnen, im Bereich der Impfmotivation ist der Zug längst abgefahren. Oder kann man da bei den Ungeimpften noch was machen, die in den letzten Wochen keine Motivation mehr gezeigt haben, sich doch noch umzuentscheiden?
Betsch: Im Moment ist es, glaube ich, schwierig. Wir sehen schon sehr lange so einen stabilen Sockel. Insgesamt von unseren Befragten sind es immer so um die sechs Prozent, die sagen: Ich will auf gar keinen Fall. Und da bewegt sich nicht viel. Also unter den Ungeimpften sind es die meisten, über 80 Prozent oder so, die sagen: Ich habe nicht und ich will auch nicht. Das kann sich im Herbst noch mal ein bisschen ändern.
Wenn zum Beispiel noch mal eine schwerwiegendere Variante käme, dann könnte sich da noch mal leicht was verändern. Aber ich glaube, es wäre gut, erst mal damit zu rechnen, dass sich daran nichts ändert. Man muss sich sehr genau überlegen, was sind die Konsequenzen davon? Die eine wäre eine Impfpflicht, wenn man sagt, man braucht eigentlich wirklich eine höhere Impfquote und man kann sie aber anders nicht erreichen. Das ist ja jetzt im Moment erst mal vom Tisch. Ich weiß nicht, ob da noch mal was kommt. Dann kann man natürlich sagen, es wird vielleicht noch mal Einschränkungen geben.
Eigenverantwortliches Handeln
Vielleicht reicht eigenverantwortliches Handeln. Dann können wir jetzt den Herbst gut nutzen, um das noch mal gut zu definieren. Das habe ich eingangs schon mal gesagt, dass wir da gar nicht richtig drüber reden, was Eigenverantwortung bedeutet. Also wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Das heißt, nicht jeder darf machen, was er will, sondern jeder schützt sich und andere weiter. Und was heißt das eigentlich? Das muss diskutiert werden.
Es wäre gut, wenn vorbereitet wird, dass wir einfache Regeln haben, die gut erklärt werden und die auch überall gleich sind. Wir haben jetzt durch diese Hotspot-Regelung im aktuellen Infektionsgesetz einen unglaublichen Flickenteppich. Ich glaube, die Länder sind selber nicht so richtig glücklich damit. Im Prinzip wird der Infektionsschutz jetzt von Parteipolitik abhängig gemacht. Ich glaube, das ist keine besonders gute Idee. Das macht das auch nicht sehr glaubwürdig.
Wie kann man verstehen, dass bei doppelt so hoher Inzidenz und höherer Hospitalisierungsrate, sagen wir mal in Thüringen im Vergleich zu Hamburg, viel lockerere Regeln gelten, weil hier vielleicht die Opposition einfach diese Hotspot-Regelung abgelehnt hat? Also das sind Dinge, die schaffen eine Erklärungsnot, die einfach nicht notwendig ist. Das stellt den Infektionsschutz in die zweite Reihe.
Und solche schlecht gemachten Regeln kann man am Ende auch nicht mehr durch gute Kommunikation retten. Das würde ich mir als Vorbereitung für den Herbst wünschen, dass man sich klarmacht: Wir brauchen noch mal Impfinfrastruktur. Also es kann ja sein, wir müssen noch mal impfen, es wird ja angepasste Impfstoffe geben. Da wird sich sicherlich bis zum Herbst noch mal einiges an Erkenntnis tun.
Ob man alle noch mal ein weiteres Mal impfen sollte oder nicht, ob mit angepasstem Impfstoff? Was kommen für neue Varianten? Da wird es noch einiges an Wissen geben, das kommt. Das Impfen muss einfach sein. Die Informationen müssen einfacher zugänglich sein, daran wird gearbeitet. Und ja, die einfachen Regeln, ich glaube, das ist das A und O. Ziele definieren. Was wollen wir erreichen? Was soll der Mensch tun? Was muss er dafür wissen? Und wie kann es dann gut erklärt werden?
Hennig: Da spielt ja dann auch im Herbst möglicherweise die Risikowahrnehmung noch mal verschärft wieder rein. Also wenn eine Variante kommt, die pathogener ist, dann ist die Risiko-Nutzen-Abwägung schon wieder eine andere. Da könnte man noch mal neu ansetzen, das besser zu kommunizieren. Wenn Sie so was lesen, was der Bundesgesundheitsminister gerade gemacht hat: "Es könnte eine Killer-Variante kommen". Funktioniert das? Ist das gute Wissenschaftskommunikation? Oder sind Sie da zusammengezuckt und haben gedacht, das geht nach hinten los?
Jenny: Das ist, was ich eben auch schon mal angesprochen hatte, Angstkommunikation. Darüber hatten wir schon gesprochen. Ich glaube, mittlerweile geht es vielen Leuten so, dass sie diese Angst in Nachrichten nicht mehr hören mögen oder sich vielleicht auch so ein bisschen veräppelt fühlen. Ich hätte es nicht so gemacht. Sagen wir es mal so. Es ist auch ohne Killer-Variante so, dass wir im Herbst einfach bei aktueller Impfquote damit rechnen müssen, dass viele ins Krankenhaus kommen werden.
Es sind auch viele über 60 nicht geimpft, die viel wahrscheinlicher ins Krankenhaus kommen als Jüngere. Auch im Bereich Impfen müssen wir zusätzlich ein besonderes Augenmerk setzen auf die "erlebten negativen Wirkungen". Dass man vielleicht im Freundeskreis jemanden hat, der oder die hat sich impfen lassen und kurz danach ist was Schlimmes passiert oder zumindest sehr Unangenehmes.
Und dass das in den Köpfen der Leute dann vielleicht mit der Impfung verknüpft wird, allerdings fälschlicherweise in vielen Fällen. Und deswegen muss man auf dieses Thema noch mal ein besonderes Augenmerk legen, weil das kann ja auch dazu führen, dass Leute, die bis jetzt sehr fürs Impfen waren, vielleicht zumindest ein bisschen ängstlicher geworden sind. Aber ich denke, für Angstnachrichten ist die Zeit zu spät. Das hat, wie gesagt, anfangs funktioniert, aber das ist nicht, was wir jetzt brauchen.
Hennig: Gibt es etwas in der Kommunikation, von dem Sie sagen, das ist in Deutschland besonders gut gelaufen?
Betsch: Wenn wir an Gesundheitskommunikation in der Pandemie denken, ist es auch ganz wichtig, dass wir an die Kommunikation durch Wissenschaftsjournalisten und Wissenschaftler denken. Da ist wirklich ganz viel gut gelaufen. Als Paradebeispiel kann man auch Ihren Podcast mit Herrn Drosten nehmen, der ja auch viel gehört und hochgelobt wurde. Es haben sehr viele Wissenschaftler sehr viel Zeit investiert, um zu kommunizieren und die Krise zu erklären.
Und genauso haben viele Wissenschaftsjournalisten einen wahnsinnig guten Job gemacht. Wen man hier auch nennen muss, ist das Science Media Center, das auch zwischen Wissenschaftlern und der Medienwelt wie so eine Art vermittelnde Rolle spielt. Und auch sehr viel selber an Information zusammengetragen und kommuniziert hat. Es sind gerade in diesen Bereichen sehr, sehr gute Informationen zusammengestellt und veröffentlich worden, die sicher den Leuten geholfen haben, die Situation sehr gut einzuschätzen und durch die Krise zu kommen.
Link-Sammlung aller erwähnten Studien in der Sonderfolge
Podcast Empfehlungen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Coronavirus