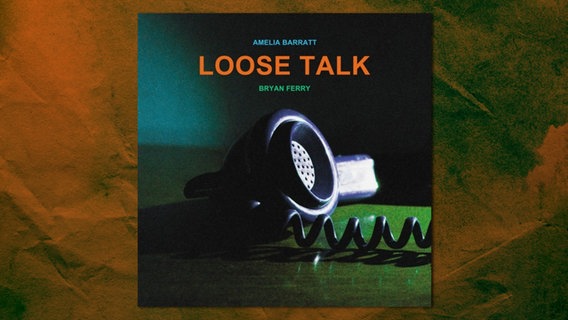"Tatami"-Komponistin Dauenhauer: Filmmusik ohne Klischees
Im gerade angelaufenen Kinofilm "Tatami" geht es um die iranische Judo-Spitzensportlerin Leila Hosseini und ihre Trainerin Maryam, die bei den Weltmeisterschaften politisch unter Druck geraten. Die in Berlin lebende Komponistin Dascha Dauenhauer hat die Musik zum Film geschrieben.
Die 35-Jährige gewann 2020 den Deutschen Filmpreis und den Europäischen Filmpreis für den Score zu "Berlin Alexanderplatz" und sprach mit NDR Kultur darüber, wie kompliziert es ist, musikalisch die richtige Stimmung erzeugen, ohne dabei Stereotypen zu bedienen.
Dascha Dauenhauer, was wollten sie in "Tatami" mit den Klängen unterstreichen oder hervorheben?
Dascha Dauenhauer: Insgesamt war es sehr wichtig, quasi den Druck des Films zu zeigen, also den Druck von Leila, den Druck von Maryam, aber auch den Druck dieser Sportart und natürlich auch die Elemente des Thrillers zu verstärken. Dazu hatten wir viel mit Percussion gearbeitet, mit japanischen Percussion-Instrumenten - also verschiedenen Taikos, kombiniert mit einer sehr simplen, aber auch emotionalen Musik. Was ich durch die Gitarren dann verstärkt habe.
Sie würden sich klischeehafte Orientalismen verbieten, habe ich gehört. Andererseits gibt es Erwartungen und Assoziationen: Die japanischen Trommeln sind dann doch da, wenn man einen Kampfsportfilm vertont?
Dauenhauer: Ja, genau. Es war irgendwie klar, dass wir ein rhythmisches Element brauchen, weil Rhythmik in diesem Kampfsport eine Rolle spielt und natürlich auch so einen Druck suggeriert. Da kommt man nicht drumherum. Aber es war irgendwie wichtig, dass ich jetzt keine iranische Musik oder persische Musik oder was auch immer komponiere. Ich versuche immer, Musik universell zu erzählen, damit sich quasi jeder Mensch damit identifizieren kann. Und dass wir das nicht in eine bestimmte Kulturecke schieben.
Wenn man James-Bond-Filme aus den 1960er- oder 1970er-Jahren guckt: Sobald man irgendeine Stadt im arabischen Raum sieht, hört man sofort den Muezzin. Was stört sie an diesen ganz klaren Bildern oder Klischees?
Dauenhauer: Es sind eben Klischees. Wir leben doch aber in einer Zeit, wo wir uns viel, viel mehr mit Rassismen und Sexismen beschäftigen - gerade im Filmbereich. Und wenn man Klischees benutzt, setzt man ja quasi direkt einen Stempel drauf, einen rassistischen Stempel. Und das möchte ich vermeiden.
John Williams schreibt eigentlich immer noch so und steht auch für eine Generation von Filmmusik. Da werden Melodien eigentlich immer mit dem gleichen Apparat geschaffen. Bei Ihnen ist es völlig anders: Die Auswahl der Sounds, die Auswahl der Instrumente sogar, bestimmt, was am Ende die Musik sein wird. Wie passiert dieser Prozess? Wie wählen Sie, was klingen soll?
Dauenhauer: Also die Konzeptfindung nimmt eigentlich immer am meisten Zeit in Anspruch. Ich glaube, bei diesem Film haben wir wirklich fünf Monate nur in der Konzeptentwicklung gearbeitet. Welche Instrumente sind die richtigen? Was sollen die erzählen? Zum Beispiel jetzt dieses Universelle, diese Einfachheit, dass man da wirklich so durchdringt in dieses Emotionale, das haben jetzt hier die Gitarren in dem Fall gelöst. Aber bis man wirklich da drauf kommt, das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Ich recorde auch selbst viele Instrumente, viele E-Gitarren-Sounds zum Beispiel, auch gestrichen, und habe das zu den akustischen Gitarrensaiten hinzugefügt. Das heißt, die Konzeptentwicklung nimmt die meiste Zeit in Anspruch, und sobald das passiert ist, geht das Komponieren an sich immer relativ schnell.
Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt. "Last Fight" heißt er, bei dem man sich auch fragt, was hören wir da eigentlich? Man könnte ja im ersten Moment auf die Idee kommen, dass sie hier mit elektronischen Sounds gearbeitet haben, aber das machen sie gar nicht so viel, wenn ich das richtig verstanden habe?
Dauenhauer: Das kommt auf den Film an. Hier zum Beispiel ist es oft die E-Gitarre, teilweise gezupft, die teilweise quasi ein Tremolo erzeugt, also mit Hilfe eines Bogens. Das ist eine Szene, wo Leila in einem totalen Delirium ist. Sie kämpft quasi schon mit ihrer Kopfverletzung, aber sie hat verloren.
Die Regisseure, Guy Nattiv und Zar Amir Ebrahimi, haben bestimmt auch unterschiedliche Vorstellungen zu arbeiten. Wie funktioniert die Kommunikation über das, was sie machen, mit den Leuten, die den Film machen?
Dauenhauer: Zar war vor allem bei dem Shoot dabei. Sie hat den Film inszeniert. Die ganze Postproduktion hat dann wieder Guy übernommen, sodass die Kommunikation etwas leichter war. Es ist ja auch immer so, wenn zu viele Köchinnen in der Küche sind, dann funktioniert es dann immer nicht so gut. Gerade wenn es um Musik geht. Da hat ja auch jeder seinen eigenen Geschmack und seine Perspektive und so weiter. Deswegen habe ich sehr, sehr eng, genauso wie auch bei "Golda", wieder mit Guy gearbeitet. Ich komponiere auch durchaus orchestrale Werke. Aber arbeite auch viel mit Syntheziser. Das ist eigentlich der Punkt, wieso ich eigentlich Filmmusik mache. Ich liebe es, mich selbst neu zu entdecken, wie ein Chamäleon und zu verändern, aber trotzdem meine DNA nicht zu verlieren.
Sie standen bestimmt einmal vor der Entscheidung: Werde ich Komponistin oder werde ich Filmkomponistin? War das auch ein ausschlaggebender Punkt?
Dauenhauer: Ja. Tatsächlich habe ich mich vor sehr vielen Jahren an der Universität der Künste in Berlin für Komposition beworben, wurde aber auch nicht angenommen, weil es dann eben hieß, wir unterrichten nur Avantgarde-Musik. Ich wollte mich aber nicht verbiegen, weil das war nicht so richtig ich. Und dann habe ich halt bei Hartmut Fladt Musiktheorie studiert und bin dann sehr glücklich, dass ich dann noch den Master in Babelsberg gemacht habe. Und es fühlt sich absolut richtig an, so wie es gelaufen ist.
Das Gespräch führte Mischa Kreiskott
Schlagwörter zu diesem Artikel
Spielfilm