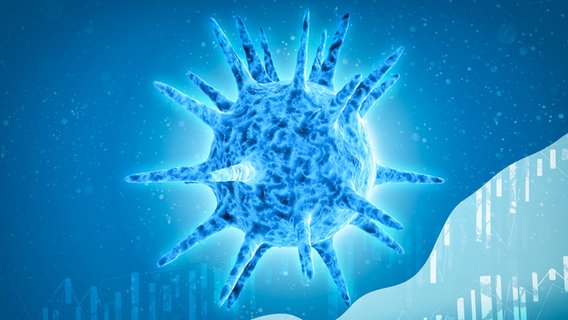Corona: Was haben wir aus der Pandemie gelernt?
Der erste endemische Corona-Winter liegt vor uns - also die erste Infekt-Saison, in der sich das Coronavirus einreiht in alle anderen Erreger, die uns in den kalten Monaten normalerweise beschäftigen: Doch das nächste Virus kommt bestimmt. Wie gut ist das Gesundheitswesen darauf vorbereitet?
"Nach der Pandemie ist vor der Pandemie", sagen Forschende. Jetzt also ist die Zeit, in der sich Politik und Wissenschaft vorbereiten sollten für die nächste Krise. Was haben wir aus der Corona-Pandemie gelernt? Wo sind Baustellen geblieben?
Fehlende Daten: Es fängt beim Impfen an

Wer sich ansieht, wie die öffentliche Gesundheit in Deutschland erforscht und überwacht wird, landet früher oder später immer bei fehlenden Daten - und mindestens beim mangelnden Überblick. In vielen Bereichen ist das ein blinder Fleck. Das fängt beim Impfen an. "Gucken Sie mal unsere Impfpässe an, wir sind weit von Digitalisierung entfernt", sagt der Pneumologe Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover. "Wenn ich einen Patienten frage: 'Wie sind Sie denn geimpft?', dann sagt er: 'Weiß ich nicht' und 'Nächstes Mal bringe ich meinen Impfpass mit.' Und dann wirft er Ihnen vier zerfledderte Irgendwas hin und sagt: 'Irgendwo habe ich noch zwei. Die habe ich aber nicht gefunden.' So kann man natürlich kein Programm aufbauen." Und nicht unkompliziert Impfdaten abrufen.
Andere Länder sind deutlich weiter: Beispiel Israel
Aber auch große Datenmengen zur konkreten Erforschung von Erregern und ihrer Entwicklung werden in anderen Ländern viel selbstverständlicher hervorgebracht und genutzt als bei uns. Die Wirksamkeit der Impfung beispielsweise konnte in Israel gut untersucht werden, weil dort die Daten Hunderttausender Krankenversicherter direkt in die Forschung eingingen. Das ist zum einen eine Frage des Datenschutzes. "Wir stehen uns da ein bisschen selber im Weg", sagt Welte. "Auch hier benötigen wir eine Diskussion: Wie viel Datenschutz brauchen und wollen wir in welcher Situation?"
Studien zur Infektionslage und Immunität in Großbritannien

In Großbritannien etwa liefen während der Pandemie regelmäßige große Bevölkerungsstudien zur Infektionslage und Immunität, die sich auch die deutsche Forschung zunutze machen konnte. Dass das möglich war, hat auch mit der Verteilung der Mittel zu tun: Im Vergleich zu Deutschland fließt in manchen anderen Ländern ein deutlich größerer Anteil der Forschungsförderung in die Universitäten, also auch in die Unikliniken. Vorteil: Dort kann die klinische Forschung Erkenntnisse sozusagen direkt am Patientenbett gewinnen.
Zum Beispiel, wenn eine neue Virusvariante aufkommt und Patienten im Krankenhaus eine Zeitlang mit zwei unterschiedlichen Varianten infiziert sind, erklärt der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité: "Allein aus dieser Übergangszeit kann man dadurch, dass man die Daten hat, diese Patienten in A und B - also alte Variante und neue Variante sortieren", erklärt Drosten. "Dann verfolgt man diese durch den ganzen medizinischen Verlauf hindurch. Das macht man bei vielen Patienten, sodass man repräsentative Proben, Stichproben kriegt. Und dann kann man tatsächlich sagen: Bei Variante B kommen beispielsweise 22 Prozent ins Krankenhaus, bei Variante A waren es aber noch 27 Prozent. Also ist wahrscheinlich die Variante B etwas milder im Verlauf."
Ohne Geld keine klinischen Forschungsnetzwerke
Mehr forschender Patientenkontakt allerdings setzt im Prinzip einen Systemwechsel voraus. "Wenn weniger Forschungsbudget von vornherein in die Universitäten geht, dann ist es sehr schwer, klinische Forschungsnetzwerke aufzubauen", so Drosten. "Diesen Mangel an Grundfinanzierung kann man nicht kompensieren durch eine kurzfristige Förderung." Die Folge: Es fehlen Daten, also auch Wissen darüber, wie sich Erreger im Patienten verhalten und entwickeln. Was die Labor-Diagnostik angeht, sieht Christian Drosten Deutschland allerdings auch für den potenziellen nächsten Pandemieerreger gut aufgestellt. Denn auch ein mutiertes Influenzavirus beispielsweise wird per PCR-Test diagnostiziert. Es gebe ausreichend Förderstrukturen, die es auch in Zukunft möglich machen könnten, die Diagnostik schnell zu entwickeln und auszurollen.
Das sei auch bei der Eindämmung der Corona-Pandemie in der ersten Welle ein großer Erfolgsfaktor gewesen. "Wir haben unsere ersten Fälle im Labor bemerkt und nicht auf der Intensivstation", so Drosten. "Zwischen Labor und Intensivstation liegen zwei bis drei Wochen." Ein entscheidender Zeitvorteil, um mit Eindämmungsmaßnahmen zu reagieren. Wie die sich auswirken können und was überhaupt dafür nötig ist, erforschen Modellierer seit knapp anderthalb Jahren in einem gemeinsamen Netzwerk, zu dem zehn Forschungsverbünde gehören.
Modellierung zur Ausbreitung von Atemwegsinfekten

Die Epidemiologin Berit Lange vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig zum Beispiel untersucht gemeinsam mit anderen Kollegen, wie sich Atemwegserkrankungen wie RSV in der Bevölkerung ausbreiten. Dabei geht es auch um Nachholeffekte - also abschätzen zu können, wie sich Maske, Abstand oder auch Schul- und Klassenschließungen auf die Bevölkerungsimmunität gegen andere Viren auswirken. Ziel wäre, so Lange, "wenn wir sagen können: Wenn diese und diese Maßnahmen eingeführt werden, ist es relativ wahrscheinlich, dass in anderthalb Jahren eine RSV-Welle sehr hoch verläuft - da müssten sich dann die Kinderkliniken entsprechend drauf einstellen."
Abwassermonitoring spielt wichtige Rolle
Wie die akute Infektionslage bevölkerungsweit aussieht, wird mittlerweile auf verschiedenen Wegen überwacht. Seit der Pandemie spielt auch das sogenannte Abwassermonitoring eine wichtige Rolle: In ausgewählten Klärwerken können Viren und Bakterien nachgewiesen werden. Bis Jahresende sollen nach dem Willen der Gesundheitsministeriums insgesamt 175 Klärwerke daran teilnehmen. Doch die Aufstockung kommt langsam voran - bisher fließen erst die Daten von weniger als der Hälfte der geplanten Standorte in die Auswertung ein. "Wir haben eine sorgfältige Beprobung an vielen Standorten", sagt der Molekularbiologe Emanuel Wyler, der am Max Delbrück-Center in Berlin an der Analyse beteiligt ist. "Was vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist, dass das alles systematisch zusammengetragen und vergleichbar gemacht wird."
Die Braunschweiger Epidemiologin Berit Lange meint dennoch: Ein wichtiges Werkzeug, schon jetzt: als Frühwarnsystem, wenn es flächendeckend mehr Ansteckungen gibt, und auch um Virusvarianten zu identifizieren. Aber: "Was ich überhaupt nicht habe beim Abwassermonitoring, ist irgendeine Form der Bevölkerungsstruktur. Also ich weiß nicht - zumindest in den bisherigen Monitoring Systemen, die wir haben - welche Altersgruppe jetzt welche Infektion in welcher Frequenz hat und welche Krankheitslast dahintersteckt.“
Arztpraxen bilden Infektionsgeschehen nicht ausreichend ab
Das wiederum wird bei den Atemwegserkrankungen über sogenannte Sentinelpraxen erfasst. Aber auch da hapert es noch: Rund 700 Arztpraxen in Deutschland übermitteln dem Robert Koch-Institut dazu ihre Daten, das sind nur etwas mehr als ein Prozent der betroffenen Praxen bundesweit. "Das führt dazu, dass wir keine wirkliche regionale, gute Abbildung des Geschehens haben, die wir dann in irgendeiner Form in Vorhersagen nutzen können", so Lange. "Es muss deutlich mehr Praxen geben, die daran teilnehmen - und das hat immer damit zu tun, wie ich die dann finanziere."
Nächster Pandemiekandidat: Wohl wieder Zoonose-Erreger

Auch Christian Drosten meint, dass man differenzierter hingucken muss - vor allem in einem Bereich, der seiner Einschätzung nach bisher zu wenig in den Blick genommen wird. Denn der nächste Pandemiekandidat dürfte wieder ein Zoonose-Erreger sein, also vom Tier auf den Menschen überspringen. Um da einen Schritt voraus zu sein, müsse vor allem die Surveillance ausgebaut werden, also die Erregerüberwachung - und zwar global. Der Fokus dürfe dabei nicht nur auf Wildtieren liegen, sondern verstärkt auch auf Nutztieren, meint Drosten. Ähnlich wie bei der Überwachung der öffentlichen Gesundheit gebe es zwar bereits etablierte Nutztier-Surveillance-Programme. Aber: "Die sind natürlich in Ländern des globalen Südens schwächer ausgeprägt", so der Virologe weiter. "Da müsste man unbedingt investieren. Ich würde es für sehr wichtig halten, dass man politische Abkommen schließt und das hoch auf eine politische Prioritätenliste setzt, wie auch andere unsichtbare, aber dennoch global relevante Prioritäten."