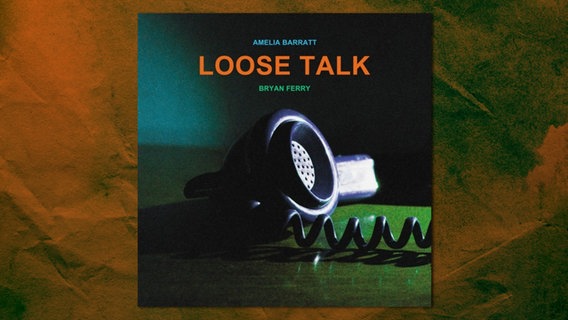Bestatterin Renske Steen: "Den Tod wieder normal machen"
Anfang des Jahres hat Renske Steen mit ihrer Geschäftspartnerin Julia Kreuch das Unternehmen "faarwel." gegründet. Die zwei versprechen "passende Bestattungen", einen herzlichen, ehrlichen und ungekünstelten Abschied. Die Musikwissenschaftlerin Renske Steen erzählt im Gespräch, warum sie ihren Job in der Klassik-Szene für das Bestattungswesen aufgegeben hat und was beide Branchen gemeinsam haben.
Wie ihre Töchter mit dem neuen Job umgehen und warum wir von Kindern einen guten Abschied lernen können, auch darüber spricht die zweifache Mutter. Außerdem geht es um kulturelle Unterschiede im Umgang mit Tod und Trauer, um die beglückenden Momente und die großen Herausforderungen der Arbeit als Bestatterin.
Frau Steen, wir alle werden sterben. Wir wissen darum, aber die meisten von uns stecken das Thema ganz hinten in eine Schublade und holen es nur dann raus, wenn es unbedingt sein muss. Sie aber haben sich den Tod quasi zur Lebensaufgabe gemacht - warum?
Renske Steen: Ich finde, es ist unheimlich wichtig, das Sterben, den Tod, wieder normaler zu machen, mehr darüber zu sprechen. Es kommen zwar ein paar Menschen zu uns und wollen über ihr eigenes Versterben sprechen oder das von nahestehenden Menschen, aber es kommen definitiv zu wenig. Ganz oft stehen wir dann vor ganz großen Fragezeichen und wissen nicht weiter.
Der Punkt, als ich gemerkt habe, dass das für mich super wichtig war, war, als ich einen eigenen Sterbefall erlebt habe. Ich glaube, so geht es ganz vielen, die in dieser Branche arbeiten: dass man dann noch mal so eine eigene Erfahrung hat. Dabei habe ich gemerkt, dass das Vorgehen des Bestattungsinstitutes damals vollkommen nicht zu meinen Wünschen gepasst hat, zu dem, was ich in dem Moment gebraucht hätte. Ich war damals überhaupt nicht in der Lage, das zu formulieren oder an irgendjemanden zu adressieren, weil ich in der Trauer war. Aber Jahre später ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte: Das muss doch möglich sein, man muss da doch noch mal rangehen können. Unsere Gesellschaft ist ja immer im Fluss und im Wandel, und die Bedürfnisse und Wünsche sind heute so viel anders als noch vor zehn, 20 oder 50 Jahren. Ich glaube, dass die Bestattungsbranche mit dem Kopf noch in diesen Zeiten steckt.
Sie haben Musikwissenschaften in Hamburg studiert, haben lange in der Klassikszene gearbeitet, aber auch als Dramaturgin und als Redakteurin. Wie kommt man von dort ins Bestattungswesen? Was muss man machen, um Bestatterin zu werden?
Steen: Bestatter ist ein Ausbildungsberuf. Es ist aber noch nicht verpflichtend, diese Ausbildung zu machen. Es gibt also auf jeden Fall die Möglichkeit eines Quereinstiegs. Als ich auf die Idee gekommen bin, dass das etwas für mich sein könnte, habe ich auch erst mal wieder aufgegeben und gedacht: Wie soll das funktionieren? Ich habe noch mal ein paar Jahre verstreichen lassen, bis ich wieder den Mut hatte, an Türen zu klopfen. Ich habe mich natürlich nicht getraut, bei den klassischen Bestattungsunternehmen anzufragen, weil ich wusste, dass die nicht irgendeine junge Musikwissenschaftlerin brauchen, die auf die Idee gekommen ist, sie könnte das auch. Den Eindruck möchte ich auf gar keinen Fall erwecken. Ich habe dann bei alternativen Bestattungsunternehmen angefragt, ob ich aushelfen könnte, ob ich mal reingucken könnte, ob ich Praktikantin sein könnte. Das habe ich gemacht, während ich noch in meinen anderen Jobs gearbeitet habe. Ich bin dort ganz schnell weiter eingestiegen, habe schon beim Einstellungsgespräch gesagt, dass ich wirklich alles mal kennenlernen will, weil mir in meinem Kopf vorschwebt, dass ich das gut könnte. Ich möchte das aber natürlich prüfen, ob ich das gut kann. Dort wurde mir die Chance gegeben, alles auszuprobieren - und dann bin ich Bestatterin geworden.
Wie sprechen Sie mit Ihren Kindern über den Job? Wie viel wissen die darüber, was Sie machen? Wie alt sind die zwei?
Steen: Die werden sieben und neun, und die wissen ganz schön viel. Die wissen, was ich mache, dass ich Verstorbene ankleide, dass ich sie wasche, dass ich manchmal auch einen körperlich anstrengenden Job habe. Die wissen, dass ich auch manchmal abends los muss, um zum Beispiel einen Verstorbenen zu überführen. Meine kleine Tochter hat in meinem vorherigen Job, in dem sie manchmal mit dabei war, weil die Kita Schließtage hatte, auch mal Särge hin- und hergeschoben oder irgendetwas ausgekleidet. Was auf gar keinen Fall vorkommt: Die haben beide noch nie eine verstorbene Person gesehen, und das finde ich auch sehr richtig, weil das auch schon Personenschutz-mäßig überhaupt nicht stattfinden darf.
Aber die beiden haben einen sehr schönen Zugang dazu. Sie haben natürlich Angst, dass ich sterbe. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was in jeder Familie irgendwann mal vorkommt, dass Kinder Angst haben vor der Sterblichkeit der eigenen Eltern. Die nehmen das aber ganz gut auf. Es gibt eine süße Geschichte, die ich immer erzähle: In der Corona-Zeit war meine große Tochter noch klein, und wir durften die Kinder nicht in die Schule bringen, sondern haben sie vorne am Tor verabschiedet. Sie sind dann selbständig zur Klasse gegangen, und dann hörte ich sie auf einmal über den ganzen Schulhof schreien: "Mama, was ich dir noch sagen wollte: Ich möchte nicht verbrannt werden!" Alle drehten sich um und dachten: Worüber redet die mit ihren Kindern? Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe zurückgerufen: "Ja, okay, habe ich mir gemerkt." Und dann ist das auch fein.
Das Gespräch führte Alexandra Friedrich. Das komplette Interview hören Sie oben auf dieser Seite - und in der ARD Audiothek.