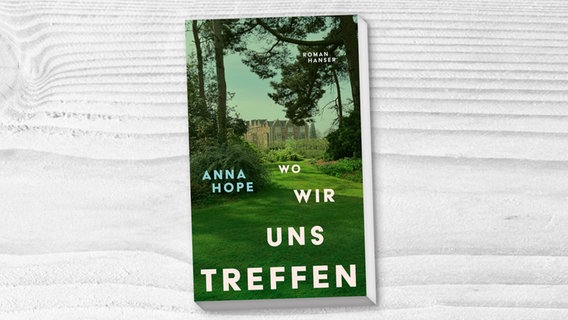Jiddisch - was ist das eigentlich?
Die jiddische Sprache wird nur noch von wenigen Menschen auf der Welt gesprochen. Die Salomo-Birnbaum-Gesellschaft in Hamburg widmet sich der Förderung und Bewahrung dieser fast 1.000 Jahre alten Sprache und Kultur. Ein Gespräch mit Marcel Seidel, Vorstand der Salomo-Birnbaum-Gesellschaft.
Herr Seidel, sind Sie mit Jiddisch aufgewachsen?

Marcel Seidel: Nein, Jiddisch habe ich erst im Studium das erste Mal kennengelernt. Vorher hatte ich damit überhaupt keine Berührung. Ich habe Osteuropastudien studiert und eigentlich Polnisch gelernt. Ich hatte auch Geschichtsseminare zur polnischen Geschichte, und da tauchten immer wieder Juden in Polen auf. Da habe ich überhaupt erst angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Das war auch die Zeit, wo YouTube größer geworden ist. Dann bin ich auf jiddische Musik gekommen und fand das ganz schön, weil sie die jiddisch-slawische und deutsche Sprache miteinander verbindet. Ich habe mich darin wiedergefunden. Dann gab es mehrere Zufälle: Ich habe erstmal einen Kurs an der Uni gemacht, dann war ich eine Zeit lang in Krakau, wo es auch eine jiddische Fakultät gab. Am Ende bin ich bei der Volkshochschule in Hamburg angekommen, und dort war ich das erste Mal in einem Jiddisch-Kurs.
Die Salomo-Birnbaum-Gesellschaft engagiert sich für die Förderung der jiddischen Sprache und auch der Kultur. Was bedeutet die jiddische Kultur für Sie, auch unabhängig von der Sprache?
Seidel: Die jiddische Kultur hat einen sehr großen Schatz, von dem man eigentlich erst einmal nichts weiß. Es ist immer eine Minderheitenkultur gewesen, weil in allen Ländern eine Nationalsprache da war. Jiddisch war eine von mehreren Parallelwelten: In dieser säkularen Spalte, auf der Ebene, wo Leute sich eher politisch engagiert haben, sind unglaublich interessante Sachen passiert. In den 20er-Jahren sind ganz moderne Sachen auf Jiddisch entstanden. Berlin war zu der Zeit ein ganz großes Zentrum, es gab eine ganz große Auswanderungswelle, die sich Anfang bis Mitte der 20er-Jahre in Berlin aufgehalten hat, teilweise sogar bis nach Hamburg geströmt ist. Auch diese internationale Verschmelzung, dass man eine Kultur hat, die alles auf ihrem Weg mit in sich einschließen kann, die durch diese ganzen anderen Nationen durchgelaufen ist und das miteinander verbindet - das hat mich so an Jiddisch angesprochen.
Seit dem Holocaust wird Jiddisch nur noch von wenigen Menschen gesprochen. Wie hat sich die Verbreitung der Sprache in den letzten Jahren entwickelt?
Seidel: Es gibt zwei unterschiedliche Strömungen: Es gibt das säkulare Jiddisch - das ist das Jiddisch, was tendenziell ausstirbt beziehungsweise sich verlagert. Die Leute, die sich politisch engagiert haben, die Zuhause jiddisch gesprochen haben, sind massiv vernichtet worden durch die Shoah, und die kommen auch nicht nach. Das hat sich eher in den akademischen Bereich verlagert. Es gibt natürlich jüngere Leute in der dritten, vierten Generation, die versuchen das von den Großeltern aufzuarbeiten. Auf der säkularen Seite tun sich die Jiddisch-Sprecher mit Leuten, die gar keine jüdischen Wurzeln haben, zusammen. Und dann entsteht da so ein ganz buntes Sammelbecken, wo auch zum Beispiel sehr viele queere Menschen drin sind.
Die andere Sparte ist die orthodoxe Sparte; die stirbt nicht aus, die wird eher größer, weil es in verschiedenen orthodoxen Kreisen diesen Aspekt gibt, dass Hebräisch die heilige Sprache ist und Jiddisch die Sprache des Alltags. Es ist also Pflicht, wenn man so will, im Alltag jiddisch zu sprechen, damit man die Sprache der Thora im Alltag nicht entweiht. Das ist also ein Selbstgänger, und da gibt es auch eine Popkultur, die nach und nach größer wird. In der Corona-Zeit hat Internet noch mal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, und die Leute treffen sich jetzt von verschiedenen Orten auf der Welt und tauschen sich aus.
Sie bieten mit der Salomo-Birnbaum-Gesellschaft in Hamburg auch Sprachkurse an. Was sind die Motivationen der Menschen, die jiddisch lernen wollen?
Seidel: Das ist sehr unterschiedlich. Bei relativ vielen hat es mit der Musik zu tun. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt auch in Hamburg selbst sehr viele jiddische Musikgruppen. Dann gibt es Leute, die auf familiären Spuren sind. Es gibt aber auch andere Gründe: Jemand, der sich für Kunst interessiert, etwa für Marc Chagall, stellt fest, dass dessen Frau jiddisch geschrieben hat, er das aber gar nicht lesen kann und gerne wissen würde, was wirklich im Original steht. Denn jiddisch ist oft nicht eins zu eins übersetzbar, da dort dieser ganze Kultur- und religiöse Aspekt eine wichtige Rolle spielt. Es ist nicht so, als würde man vom Französischen ins Deutsche übersetzten. Wenn man im Hinterkopf haben muss, welche Bräuche zu welchem Feiertag gehören, oder was in der Thora zu einem bestimmten Symbol steht, dann hat das natürlich eine andere Dimension.
Sie haben auch einen jiddischen Stammtisch. Wer trifft sich dort, und was wird zu trinken gereicht?
Seidel: Es treffen sich ganz unterschiedliche Altersgruppen. Das geht von Ende 20 bis Anfang, Mitte 80. Es sind Mitglieder der Birnbaum-Gesellschaft; unsere Gesellschaft hat 70 bis 80 Mitglieder. Die Zusammensetzung ist jedes Mal ein bisschen anders. Es ist schwierig, in Hamburg koschere Speisen zu bekommen, und wir sind ja überwiegend eine nichtjüdische Gesellschaft, nur mit jiddischem Schwerpunkt. Also trinkt jeder, was er möchte.
Das Interview führte Charlotte Oelschlegel.