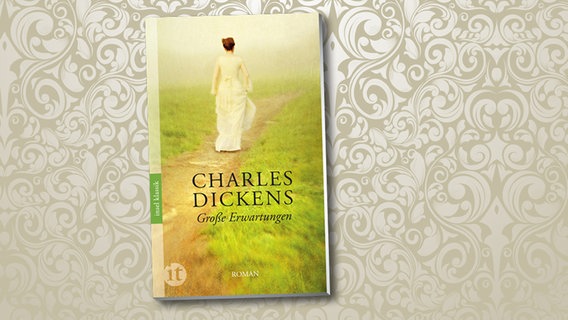"Der Herbst des Patriarchen" von Gabriel García Márquez
"Der Herbst des Patriarchen" ist wohl Márquez' kühnster, reifster und komplexester Roman. Man kann den Roman als Anklagerede und Trauerlitanei lesen, aber auch als Text über die Einsamkeit der Macht
Als Gabriel García Márquez im April 2014 im Alter von 87 Jahren starb, wurde er in den Nachrufen weltweit als größter Schriftsteller seiner Epoche bezeichnet, als Mythenstifter und literarischer Revolutionär. Dass Literatur eine Neuerschaffung der Welt sein kann, bei García Márquez konnte man es noch einmal erleben. Er hat die Weltliteratur gleich um ein halbes Dutzend großer Romane bereichert, von denen "Der Herbst des Patriarchen" wahrscheinlich sein kühnster, reifster und erzählerisch komplexester ist. Er wurde 1975 publiziert und stellte den vorläufigen Schlusspunkt unter einem literarischen Genre dar: dem lateinamerikanischen Diktatorenroman.
Abgesang auf die Gattung des Diktatorenromans
Diktatoren oder Caudillos haben in unterschiedlichen Ausprägungen die Geschichte des ganzen Kontinents bestimmt, und zwar so tiefgreifend, dass sich um sie eine besondere Aura, ja eine eigene Mythologie gebildet hat. Immer wieder wurden sie zum Gegenstand großer Literatur. "Der Herbst des Patriarchen" von García Márquez stellt bereits einen Abgesang dieser Gattung dar. Jedes der sechs Kapitel des Buches, in dem ohne chronologische Ordnung die Geschichte eines fiktiven Landes am Rande der Karibik erzählt wird, beginnt mit dem Tod des Diktators, dessen Alter niemand kennt, nicht einmal er selbst, denn er ist so alt, dass er als einziger Lebender den Halleyschen Kometen, der alle sechsundsiebzig Jahre wiederkehrt, zweimal, oder sogar dreimal, gesehen hat.
Dieser Diktator verkörpert das Prinzip der Herrschaft und der Macht überhaupt, aber auch die Geschichte seines Kontinents seit Simon Bolívars Befreiungskriegen, ja selbst von Columbus an. Er ist ein Mann aus dem Volk, ein Revolutionär seinen Ursprüngen nach, im Laufe der Zeit durch die Macht deformiert, schließlich ein Gefangener der eigenen Macht in einer selbstgeschaffenen Welt der Lügen und Intrigen, einsam und verlassen in seinem verrottenden Palast, zwischen Hühnern, Kühen und Lakaien wie einst Romulus, der letzte Kaiser von Rom. Alle seine Reichtümer hat er im Laufe seiner endlosen Herrschaft an den großen Nachbarn im Norden abgetreten, und als es nichts mehr gibt, womit die Auslandsschulden bezahlt werden können, verkauft er auch noch das karibische Meer, das stückweise nach Arizona abtransportiert wird, eine Wüste von Staub zurücklassend, wo einmal die karibische See leuchtete."
Die Handlung von "Der Herbst des Patriarchen"
García Márquez führt uns in eine Alptraumwelt, die beschrieben wird in einer unerhört dichten, gegenständlichen, detailgesättigten Sprache, die mit ihrem breit fließenden, beharrlich kreisenden Imperfekt den Leser in einen Malstrom aus Wörtern, Sätzen und Bildern hineinzieht. Es sind viele Stimmen, die sich ablösen, überlagern, polyphon zusammenklingen, die Gesetze von Raum und Zeit aus den Angeln heben, auch wenn es sich auf den ersten Blick nur um eine Stimme zu handeln scheint, jene feste, kraftvolle, ruhig fließenden Erzählerstimme, in der alle anderen Stimmen sich wie in einem großen Chor vereinigen.
Man kann den Roman als Anklagerede und Trauerlitanei lesen, über weite Strecken auch als Roman über die Einsamkeit der Macht. Endlich meint man zu begreifen, dass der Staatenlenker auch als Weltenlenker verstanden werden kann, dass der Patriarch zugleich Gott ist, seine Ewigkeit die Ewigkeit Gottes, und dass das Reich der Freiheit, dass die Unterdrückten ersehnen, erst kommen kann, wenn alle Herrschaft endet, die menschliche wie die göttliche. Der Tod des Patriarchen ist das "Ende der Schöpfung", insofern sie göttlich ist; mit seinem Tod erst kann sie menschlich werden. Zurück bleiben die, die den toten Diktator und den toten Gott überleben, das Volk, die Armen, die Unterdrückten, deren Stimmen sich zuletzt - am Schluss des sechsten Kapitels, das aus einem einzigen, über fünfzig Seiten langen Satz besteht - zu einem "Wir" vereinigen, das vom Tyrannen glücklich Abschied nimmt.
Schlagwörter zu diesem Artikel
Romane