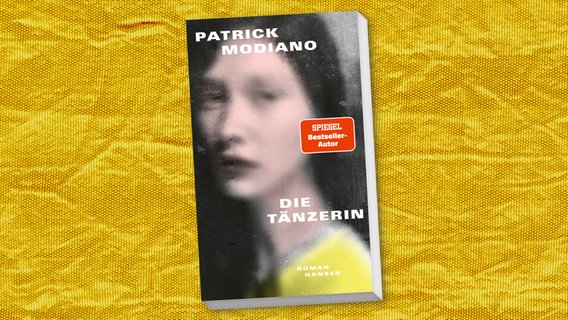"Back to Black" - "nicht mehr als eine schnöde Liebesgeschichte"
Der Kinofilm über das Leben der britischen Jazz- und Soulikone Amy Winehouse läuft erfolgreich, aber spaltet die Feuilletons. Die Musikjournalistin Laura Ewert meint, das Biopic über Amy Winehouse wird der Sängerin nicht gerecht und ist nicht gut erzählt.
"Back to Black" - der Kinofilm über das Leben der britischen Jazz- und Soulikone Amy Winehouse ist der erste Film, der die Unterstützung von Amys Familie hat. Also darf schon gleich einmal bezweifelt werden, wie "unabhängig" so eine Darstellung ist. Ein Spielfilm kann ohnehin unmöglich die Karriere und das Leben von Amy Winehouse vollständig zeigen. Es werden immer Momentaufnahmen und Ausschnitte bleiben. Warum faszinieren uns Filmbiographien dennoch so sehr, gerade auch die über musikalische Größen? Fragen darüber an die Musikjournalistin Laura Ewert.
Laura, was war denn die letzte Musikbiographie, die Du selbst gesehen hast?
Laura Ewert: Also im Fernsehen war es die ARD-Doku über "Echt", die deutsche Popband aus den 90ern. Im Kino ist es tatsächlich schon ein bisschen länger her, da habe ich "I Wanna Dance With Somebody" über Whitney Houston geschaut. Das war deswegen so gut, weil man diese stimmlich und musikalisch wirklich irren Auftritte der Sängerin nochmal erleben konnte. Da konnte man mitsingen und mitweinen, weil dieser ganze Druck, der auf Popstars auf weiblichen und schwarzen Popstars noch mehr lastet, so nachvollziehbar wurde. Und weil diese Geschichte natürlich auch so unheimlich tragisch endet.
Es kommt eine Biografie nach der anderen in die Kinos oder in die Streamingdienste. Warum ist das gerade so ein Ding?
Ewert: Das hat natürlich erstmal monetäre Gründe. Wir sehen das nicht nur bei Musikerinnen und Musikern. Die Filmfirmen setzen auch Biopics. Lady Gaga besetzen - das funktioniert einfach. Man kriegt Fans so rein. Oder nehmen wir den Konzertfilm von Taylor Swift. Da tanzen und singen ihre Fans im Kino. Sie sagt den Fans: "guckt mal, ich habe euch einen Konzertfilm geschenkt" und wird nebenbei zur Milliardärin.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so wie jetzt bei Echt und bei Whitney Houston: Diese Geschichten, die haben Fallhöhen. Die Band Echt wurde in der Öffentlichkeit total hart angegangen. Bei Konzerten wurden Flaschen auf die geschmissen. Bei Houston haben wir Gewalt in der Beziehung, Drogensucht und Tod. Das sind Stoffe, aus denen Filme gemacht sind. Bei Echt kommt noch mal dazu, das richtet sich an eine Generation, die wird nostalgisch, die möchte ihre Jugend noch mal sehen. Das zieht uns natürlich ins Kino beziehungsweise an den Fernseher.
Die Echt-Doku von Kim Frank wurde aus Archivmaterial selbst collagiert. Jetzt haben wir Amy und andere fiktionale Stoffe, wo ganz klar ist: Wir entscheiden uns jetzt für einen Weg. Wir erzählen eine Geschichte, so wie wir die sehen. Macht das einen Teil des Erfolgs aus? Dass man eine vermeintliche Klarheit bekommt?
Ewert: Vielleicht ist die Dokumentation oftmals der bessere Weg, um eine Klarheit zu bekommen. Aber nicht jeder hat so viel Material oder rückt es auch raus. Bei Echt ist es so, die haben selber gefilmt. Tausende von Stunden konnten sie da collagieren. Dokumentationen kann man eben nur machen, wo es Material gibt. Ob die Fiktion und die gekünstelte Erzählung den Erfolg ausmacht, weiß ich gar nicht. Im Fall von "Back to Black" bei Amy Winehouse, würde ich sagen: das ist genau der Grund, warum das nicht so funktioniert. Man macht aus dieser sehr kantigen, speziellen Sängerin, wo es viel zu erzählen gibt, über weibliche Rollen, über wie haben Popstars sich zu verhalten - da macht man so eine schnöde Liebesgeschichte, da ist es doch eher schlecht gelaufen.
ich glaube, bei Biopics hängt der Erfolg auch davon ab, wie lange der Künstler oder die Künstlerin schon tot ist. Wie lange der Erfolg her ist. Wir haben "Bohemian Rhapsody" dieses Filmdrama über Freddie Mercury, das ist 2018 erschienen und der starb 1991, also 27 Jahre später. Bei Amy Winehouse haben wir jetzt 13 Jahre - sie starb ja 2011. Das sind dann Geschichten, die sind noch sehr nah dran. Da wird es dann unangenehm, wenn man diese Unterschiede zwischen Realität und Fiktion so stark merkt.
Oft haben Hinterbliebene Nachkommen ihre Finger im Spiel - in diesem Fall der Vater von Amy Winehouse. Der wurde für sein Verhalten als "Eishockeyvater" viel kritisiert. Kann man da eine reale Darstellung erwarten?
Ewert: Ich weiß gar nicht, ob er da mitgearbeitet hat. Die Regisseurin Sam Taylor-Johnson, die hat in einem Interview gesagt, die Familie hätte da nichts abnehmen sollen. Das weiß man natürlich nicht. Aber die Rolle der Familie, die Rolle des Vaters wäre natürlich der interessantere Stoff gewesen für den Film, als diese Liebe zu einem Rowdy, der sie auf Drogen setzt.
Aber die Frage ist doch: Suchen wir eigentlich nach einer realen Darstellung in solchen Filmen über Musikerinnen und Musiker? Oder wollen wir die Heldengeschichte erzählt bekommen? Abstürzen und wieder aufsteigen? Also mit so einer gewissen Fallhöhe.
Es gibt jetzt zum Beispiel diese zwei Filme über Bob Marley: "One Love", der in diesem Jahr erschienen ist und dann "Marley" eine Doku aus 2012. Da merkt man den Einfluss der Familie auch sehr stark. Das wurde auch immer erzählt in Interviews: Die Familie hat da doch den Finger drauf. Das kann man natürlich verstehen. Die Familie eines Verstorbenen möchte den natürlich lieber als Helden erzählen. Ich finde, es muss auch gar nicht das reale Leben sein. Aber es muss doch eben gut erzählt sein. Also man muss doch eine Geschichte spinnen, die weit mehr erzählt als eine schnöde Liebesgeschichte .
Das Interview führte Mischa Kreiskott.