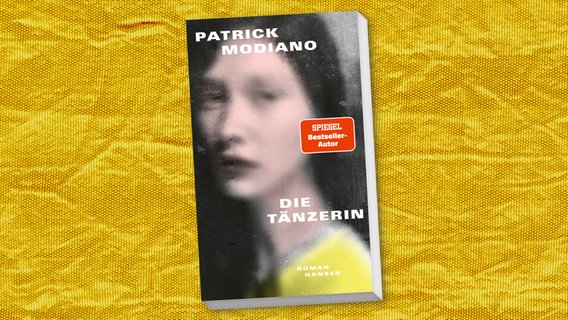"Der Geschmack der Freiheit": Ute Cohens Geschichte der Kulinarik
Wie haben historische Ereignisse unsere Esskultur geprägt - und welche Bedeutung hat dies für unser Verständnis von Tradition und Genuss heute? Ute Cohen hat darüber das Buch "Der Geschmack der Freiheit" geschrieben.
Essen ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern spiegelt seit jeher auch Kultur und Gesellschaft wider. Von den opulenten Festmählern der Römer über die Einführung exotischer Gewürze im Mittelalter bis hin zu den globalen Trends unserer Zeit - jede Epoche hat ihre eigenen kulinarischen Besonderheiten hervorgebracht. Im Interview spricht Autorin Ute Cohen über die Entstehung der Restaurants und warum es wichtig ist, über das Essen zu plaudern.
Frau Cohen, wie definieren Sie denn Kulinarik genau? Ist es wirklich nur "Kochkunst", wie es im Wörterbuch zu lesen ist?
Ute Cohen: Ein bisschen weiter, weil Kochkunst so akademisch oder beschränkt klingt. Ich habe das noch ausgedehnt auf das Lukullische, auf das Schwelgende, auf das, was dieses Wort mitklingen lässt, wenn man nicht die Bedeutung kennt. Kulinarik - das zergeht doch auf der Zunge, oder? Genau in diesen Bereich habe ich mich hineinbegeben.
Wenn wir improvisieren, wenn wir erproben, dann sind wir sofort bei dem großen Thema: der Geschmack der Freiheit. Aber welche Aspekte von Freiheit sehen Sie noch, wenn Sie diese Geschichte der Kulinarik schreiben?
Cohen: Wir gehen jetzt mal in die Historie: Ich habe auch die Entstehung der Restaurants im Zeitalter der Französischen Revolution beschrieben, dass die da entstanden sind durch die Sprengkraft dieser Zeit und diese gesellschaftlichen Veränderungen. Natürlich war das ein unglaubliches Experimentierfeld für diese Köche, die vorher in Adelshäusern tätig waren, dass die endlich mal ihr eigenes Ding machen konnten.
Wie hat das die Küche verändert - von der eher protzigen Küche in Versailles, wo es auch um Repräsentation ging, hin zu Restaurants und Gasthäusern?
Cohen: Man musste auch ein bisschen im Kontext bürgerlicher Effizienz denken. Man hatte nicht das ganze Personal, man hat anders aufgedeckt, man hat anders serviert. Man hat eine Speisekarte entwickelt, wo bestimmte Gerichte drauf waren, und die wurden irgendwann unglaublich aufgebläht, weil die bürgerliche Wahlfreiheit ins Exzessive ging und immer mehr Angebote wollte. Aber am Anfang war das schon durchdacht, man hat geguckt: Was kann ich heute anbieten? Was gibt es Frisches? In welchem Rahmen kann ich das überhaupt umsetzen?
Das ist eine Herausforderung, von der wir heute wieder stehen: Einerseits überlegen wir, wie wir diese Sehnsucht nach einer Wahlfreiheit mit den ökologischen Gegebenheiten oder auch mit bestimmten Beschränkungen vereinbaren können. So wie damals aufgetischt wurde, vor der Französischen Revolution, da war das vor allem für das Auge. Man musste sich visuell sättigen. Es war vollkommen egal, ob das Essen letztlich kalt war. Dass alle Aspekte miteinbezogen wurden, das geschah erst danach - zum Beispiel auch durch eine Veränderung der Tischkultur. Wie wir servieren - das vergessen wir auch gerne -, ist auf russische Art. Das ist nicht à la française, weil wir einen Gang nach dem anderen haben. Das hat Alexander Kurakin, der damalige Botschafter Russlands in Frankreich, eingeführt und damit Schule gemacht.
Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir heute eine reiche Auswahl an Positionen: sich vegan ernähren, sich Eiweiß-betont ernähren, sich regional ernähren. Wie frei sind wir da heute? Denn es gibt für all das auch eine Gegenbewegung - zum Beispiel einen CSU-Politiker, der ganz demonstrativ Fleisch essen muss?
Cohen: So etwas kann man natürlich auch als eine Belustigung betrachten. Oder vielleicht als einen kleinen Hinweis: Sollen wir vielleicht wieder mehr unseren Geschmacksknospen folgen als unserm Brain? Dass wir uns selbst nicht einengen lassen, das kommt auch ein bisschen auf uns an.
Wenn wir über Wahlfreiheit oder Identitätskonstruktion sprechen, inwiefern sind wir da aber nicht auch Knechte und Mägde der Ernährung unserer Kindheit? Wer bis zu seinem sechsten Lebensjahr nicht viele Gemüsesorten und keine Bitterstoffe kennengelernt hat, der wird damit wahrscheinlich nicht mehr so schnell anfangen.
Cohen: Meine Kinder sind teils in Frankreich und teils in Deutschland aufgewachsen, und in der französischen Grundschule gibt es so was wie die "Woche des Geschmacks". Da lernen die Kinder eine Woche lang Verkosten: Die probieren alles Mögliche aus, die lassen sich die Augen verbinden und machen Blindverkostung. Das prägt enorm. Die lernen auch, über Essen zu plaudern und da einen Lustgewinn, aber auch einen Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen.
Was haben Sie denn darüber herausgefunden, wie wir über Essen sprechen?
Cohen: Das ist den meisten Köchen extrem wichtig. Ich höre immer wieder von Köchen, dass es ihnen auch um die Erschaffung einer neuen Sprache geht, eine Sprache der Kulinarik. Man sieht das zum Beispiel auch am Wandel der Speisekarten. Köche ließen sich vom Pomp der Adelshäuser inspirierten, von der Sprache der Architektur und der Musik, aber auch vom Fischmarkt: Derbheit und Eleganz gehen da eine ganz prickelnde Allianz ein. Dazu kommt noch, dass bei Tisch schon immer viel geplaudert wurde. Ein gemeinsamer Genuss setzt auch Ideen frei, und diese Sprache ist in dem Moment dann vollgesogen von sinnlichem Erleben und verliert dabei auch ihre Sprödigkeit. Über Essen zu plaudern, das verstärkt den Genuss, das ist ein doppeltes Vergnügen und ein zweifaches orales Erlebnis.
In den vielen kulinarischen Sendungen im Fernsehen höre ich zu häufig ein undifferenziertes "Lecker!" - das sagt ja nun gar nichts, oder?
Cohen: Oh ja, obwohl das schon fast wieder ausgestorben ist, weil sich alle immer lustig darüber machen. Wenn ich ein Kind höre, das zum Beispiel sagt: "Oh, lecker!", da kommt doch so ein originärer Genuss zum Ausdruck. Das muss man nicht verpönen, ich bin da nicht so strikt, dass man diese "Lecker!" aus unserem Vokabular verbannen muss.
Das Interview führte Mischa Kreiskott.