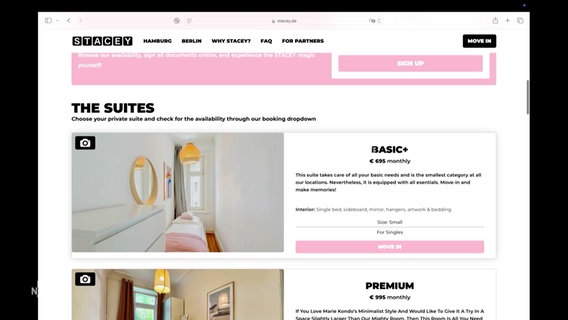Medizin-Nachwuchs hilft Obdachlosen
Die anhaltende Grippewelle hat viele Menschen erwischt, aber Obdachlose trifft eine Infektion mit dem Virus besonders hart. Sie können die ersten Grippeanzeichen nur selten mit heißer Zitrone und einem Tag im warmen Bett kurieren.
In Hamburg leben rund 2.000 Menschen auf der Straße, viele von ihnen haben keine Krankenversicherung. Ihre Not lindert nun eine studentische Poliklinik. Im "CaFée mit Herz", einer sozialen Einrichtung für Obdachlose im Stadtteil St. Pauli, behandeln Medizinstudenten ein Mal pro Woche kranke Patienten unter der Aufsicht eines ausgebildeten Arztes. Die Nachfrage ist enorm.
Ein Jahr lang von der Idee bis zur Praxis

Freitag ist Doktortag im "CaFée mit Herz". 200 bis 300 Obdachlose essen hier täglich zu Mittag. In einem Nebenraum bereiten sich Louisa Lehner und zwei ihrer Kommilitonen auf die heutige Sprechstunde vor. Ihre studentische Poliklinik ("Stupoli") öffnet in 20 Minuten zum vierten Mal. Bei den ersten drei Terminen hatten die Studenten schon viel zu tun: "Es waren von zehn Patienten vielleicht immer so zwei, drei dabei mit grippalen Effekten. Es war ja doch die in den vergangenen Wochen minus zehn, minus 15 Grad - und auch in den Krankenhäusern ist momentan einfach die Grippewelle sehr ausgeprägt. Das merken wir hier auch."
Lehner ist im zehnten Semester. Ein Jahr lang hat sie zusammen mit anderen Studenten die "Stupoli"-Initiative aufgebaut: den Raum dafür gesucht und gefunden, Medikamente und medizinische Geräte organisiert, Ärzte überzeugt, die Sprechstunde ehrenamtlich zu begleiten.
Seit 20 Jahren nicht beim Arzt
Und ihre Idee funktioniert nun in der Praxis: Zehn Menschen sitzen bereits draußen im provisorischen Wartezimmer. Karl-Heinz kommt als erster an die Reihe - er war bereits seit 20 Jahren nicht mehr beim Arzt: "Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht."
Der 62-Jährige hat keine eigene Wohnung, er lebt bei Freunden und Familie. Von der "Stupoli" hat er im Fernsehen gehört: "Und dann denke ich auch: 'Kannst du ja Freitag mal hergehen. Die Beschwerden, weswegen ich hierher gekommen bin, habe ich schon seit einem Jahr. Ich habe schon gedacht, mir fällt das Bein bald ab. Das eine Bein ist zehn Zentimeter dicker als das andere. Wenn ich jetzt stehe, habe ich auch Wasser in den Beinen."
Die Studenten nehmen dem Patienten Blut ab, der Arzt gibt ihnen Anweisungen und Tipps. Als das Blut in der Spritze ist, zieht sich Karl-Heinz seinen knallroten Pulli wieder an und verabschiedet sich. Die Ergebnisse bekommt er beim nächsten Mal.
500.000 Menschen ohne Krankenversicherung?
Vor der Tür der "Stupoli" warten mittlerweile noch mehr Patienten. Die genaue Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung wird in Deutschland nicht erfasst. Die Bundesregierung schätzt sie auf 80.000, Hilfsorganisationen gehen von deutlich mehr aus: von bis zu einer halben Million.
Maria gehört zu ihnen, seit vergangenem Sommer ist sie auch obdachlos: "Gesundheit geht für mich immer noch vor. Ich habe keine Unterstützung von Behörden, bekomme von nirgendwo Hilfe. Vor zwei Wochen habe ich auf einmal einen Stich in der linken Seite im Nacken gespürt. Zwei Tage war die halbe Hand taub. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ein Herzinfarkt oder so?" In der "Stupoli" hofft sie nun auf Hilfe.
"Ältere Menschen haben immer was"
Neben Maria sitzt der 68 Jahre alte Israel Rosenthal. "Ältere Menschen haben immer was", sagt er. "Prostata, Leistenbruch-Operation, Fistel-Operation, Hämorrhoiden-Operation, Augen, und, und, und ... Studenten liebe ich sehr, weil ich auch Student war mal vor circa 55 Jahren. Jetzt bin ich hier in Hamburg - obdachlos."
Doktor der Biochemie sei er gewesen, aber dann im Stuttgarter Nachtleben verloren gegangen, erzählt Rosenthal. Er ist froh, dass er nun im Behandlungszimmer der "Stupoli" Studenten trifft, die Ärzte werden wollen. Für ihn ist das so etwas wie eine Verbindung zurück in sein altes Leben.
"Menschen helfen, die richtig Hilfe brauchen"
Einer der Medizin-Studenten ist Jendrick Becker-Assmann. Er steht voll hinter der "Stupoli": "Es ist generell gut, sich auch gesellschaftlich einzubringen. Sonst sitzt man viel in den Hörsälen in der Uni, kommt vielleicht mal in die Krankenhäuser rein. Jetzt wirklich Menschen, die richtig Hilfe brauchen und irgendwie durchs Raster gefallen sind, helfen zu können, das ist eine schöne Sache."
Schlagwörter zu diesem Artikel
Krankenversicherung