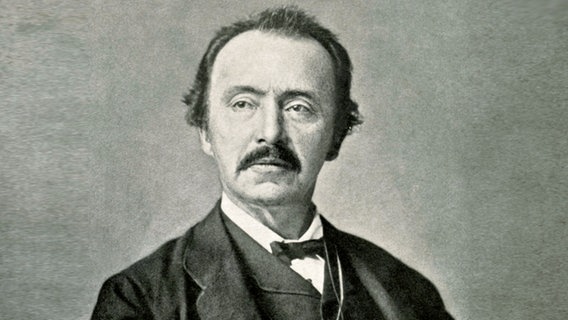Anno 1523: Ein Vertrag bewahrt das Land vor der Zersplitterung
Vor 500 Jahren haben sich die Ritter, die Städte und die Kirche in Mecklenburg zur Landständischen Union zusammengetan. Wie der Historiker Wolf Karge sagt, bewahrte der Vertrag das Land vor der Zersplitterung.
Am 1. August 1523 haben die adeligen Ritter, die Vertreter der Städte und der Kirche in Sagsdorf an der Warnow einen Bund geschlossen, ohne den die Geschichte Mecklenburgs wohl anders verlaufen wäre. Ohne die vor 500 Jahren gegründete Landständische Union "hätte sich Mecklenburg im Laufe der Jahrhunderte noch mehr zersplittert", sagt Wolf Karge. "Es war ohnehin kein großes Land und bedeutend sowieso nicht. Und diese Zersplitterung wurde aufgehalten", fügt der Historiker im NDR Interview hinzu. "Also ein wichtiger Moment für die Geschichte unseres Landes."
Vor 500 Jahre ging es ums Geld
Zu den Landständen zählten allgemein die Gutsbesitzer, die Städte und die Geistlichkeit. Im 16. Jahrhundert gab es laut Karge in Mecklenburg drei Landkreise: Mecklenburg, in der Region um Güstrow das Land Werle und das Land Stargard in der Neubrandenburger Gegend. In diesen Kreisen hatte sich die Ritterschaft zusammengefunden. Beim Zusammenschluss zur Landständischen Union im August 1523 ging es dann vor allem ums Geld. Der Adel und die Städte wollten ein gewichtiges Wort mitreden, wenn es um die Steuern ging, die sie an die Mecklenburger Herzöge zahlen mussten.
170 Familien bezeichneten sich als Uradel
"Es waren 170 Adelsfamilien, die sich seinerzeit zusammengeschlossen haben", berichtet Karge, "darunter so bekannte Namen wie Plessen, Oertzen, Malzahn und so weiter, die wir auch heute noch kennen.“ Diese Adelsfamilien bezeichneten sich später als Uradelige – als Abgrenzung gegenüber jenen, die erst später geadelt wurden. Die Bauern hatten beim Vertrag vom 1. August 1523 kein Mitspracherecht. Die Landständische Union hatte in ihren Grundzügen knapp 400 Jahre Bestand. Regelmäßig trafen sich die Landstände zum Landtag in Sternberg oder in Malchin - und hinderten die Herzöge bis zum Schluss, eine modernere Landesverfassung auf den Weg zu bringen. Erst nach der Revolution 1918 wurden in Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz demokratische Parlamente gewählt.