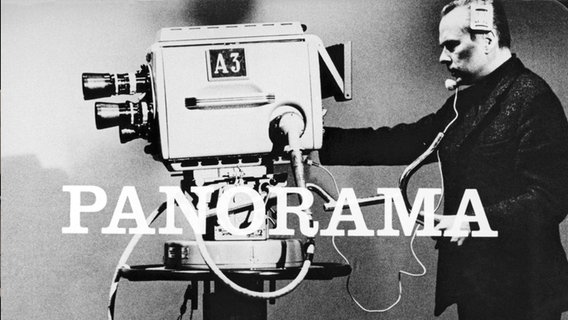Flüchtlinge und Helfer: Willkommen in der Wirklichkeit
Nach jeder Sendung schreiben mir Zuschauer. Manche loben einen Beitrag, andere kritisieren konkret Punkte, die sie anders sehen. Aber inzwischen machen viele in ihren Zuschriften auch einfach ihrer Wut Luft. Ihrer Unzufriedenheit über die Flüchtlingspolitik, über die vielen Menschen, die da kämen. Die wenigsten dieser Schreiber haben direkt mit Flüchtlingen zu tun, aber sie sind irgendwie sauer. Darauf zu antworten ist nicht leicht. Mitunter aber bekomme ich Post, die mich nachdenklich stimmt. Es sind differenzierte Zwischenrufe, denen man anmerkt, dass sich da einer hingesetzt hat, weil er sich Sorgen macht, weil er aus seiner persönlichen Erfahrung berichtet, weil er eigentlich kein schwarz oder weiß will, sondern eine differenzierte Betrachtung.
So hat mir ein Mann aus Lemgo geschrieben, Wolfgang Frangenberg, 72, früher hat er ein Jugendamt geleitet, heute ist er Pensionär. Seit vergangenem Herbst kümmert er sich ehrenamtlich um zwölf Männer aus Syrien, Afghanistan und dem Iran. Frangenberg begleitet die Männer zur Ausländerbehörde oder zum Jobcenter, organisiert Ausflüge und gibt Deutschnachhilfe. Er gehört zu den Bürgern, die sich gegen Jammern und Angsthaben entschieden haben. Er packt lieber an. Doch seit ein paar Wochen wachsen seine Sorgen. So berichtet er mir in seiner Mail von seinem Frust: "Wir, die ehrenamtlich für die Flüchtlinge Tätigen, arbeiten hart und emsig neben den sozialen Institutionen, aber es fehlt ein Masterplan." Er schreibt, dass die Flüchtlinge nicht richtig mitziehen, dass es nicht recht vorangeht. Diese Mail hat mich interessiert. Was ist passiert, wenn selbst Menschen wie Herr Frangenberg anfangen zu zweifeln? Diese Mail ist der Anlass für eine Reise durch die Republik. Ich will wissen, wie Integration gelingen soll, woran es hapert, vor was sich Bürger sorgen, welche Erwartungen Flüchtlinge und Deutsche haben.
Ernüchterte Stimmung
Als ich Wolfgang Frangenberg in Lemgo besuche, in seinem Haus, in dem er am Tag zuvor noch mit seinen Syrern, oder besser seinen "Burschen", wie er sie nennt, gekocht hat, empfängt er mich mit Kaffee und Keksen. Es mache ihm Spaß, sich um die Männer zu kümmern, erzählt er mir, auch wenn viele seiner Bekannten gar nicht verstünden, warum er sich das antue, aber für ihn sei das eine zutiefst befriedigende, sinnstiftende Aufgabe. Herr Frangenberg ist ein kultivierter, freundlicher, zuvorkommender Herr, der ein klares Ziel hat. Selbstständig sollen sie werden, "seine" Flüchtlinge, schnell die Sprache lernen, Arbeit finden. Und dabei helfe er. Aber es liefe nicht so, wie er sich das gedacht habe. Er habe ihnen große Plakate mit Grammatikregeln gemalt, Deklination und Konjugation. "Ich habe gesagt: Hängt es doch an die Wand, damit ihr immer wieder seht, dass es regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben im Deutschen gibt", erzählt er. Doch das Plakat liege in der Ecke. "Wie oft klopfe ich an, die Türe ist verschlossen, und dann - nach langem Klopfen - wird aufgemacht, und alle liegen im Bett?" Das sei ihm nicht begreiflich. Irgendwie wirkt Frangenberg etwas ernüchtert und ratlos. Und auch ich frage mich, warum seine Schützlinge die von ihm angebotene Hilfe nicht richtig annehmen.
Große Erwartungen
Wenig später lerne ich sie kennen, seine Männer. Herr Frangenberg hat einen Ausflug organisiert, es geht ins Museum. Er will den Neuankömmlingen die Kultur der Gegend nahebringen: "Renaissance des Weserberglandes", da muss selbst ich mich für erwärmen. Aber Abu Hassan, Rezan Shiko und die anderen Flüchtlinge machen tapfer mit. Mit Händen und Wortbruchstücken aus Englisch, Arabisch, und Persisch arbeiten wir uns gemeinsam durch die Geschichte. Aber eigentlich wollen die Männer mit mir über etwas anderes reden. Deshalb haben sie extra Kuchen gebacken. Ich werde von allen Seiten bestürmt: die Situation in Afghanistan, in Syrien, die Terroristen, Putin, IS, die Taliban, was ist mit den Grenzen, Deutschland soll helfen, man sei dankbar, aber wir müssten noch viel mehr tun. Die Erwartungen in dieser Kuchenrunde sind riesig. Wie soll ich diesen Männern, bei denen es um ihre Existenz geht, erklären, dass Europa gerade zu zerbrechen droht angesichts der Flüchtlingszahlen, dass viele sie überhaupt nicht hier haben wollen, dass Deutschland jetzt schon mit sich ringt.
Was ist mit der Familie?
Aber warum nehmen Sie die Hilfe von Wolfgang Frangenberg nicht so richtig an, will ich dann doch wissen. Rezan Shiko ist im September aus Syrien gekommen. Er ist 40, aber er sieht älter aus. Müde, und traurig. Er wolle ja die Sprache lernen, beteuert er, unbedingt, aber im Moment würde er seinen Kopf nicht freibekommen. Er ist allein geflohen. Seine Frau und die drei Kinder sind noch in Syrien. Der Schlepper habe ihm erzählt, er könne seine Familie später problemlos nachholen. "Ich kann nicht schlafen, immerzu denke ich nur an meine Familie", sagt Rezan. Morgens ist er dann völlig erschöpft, auf regelmäßige und unregelmäßige Verben kann er sich dann nur schwer konzentrieren. Als Wolfgang Frangenberg das hört, wird er ganz nachdenklich.
Auch die anderen beteuern, ja, natürlich wollten sie arbeiten. Wenn ich frage was, schauen sie mich verwundert an. Nach dem Motto, wieso, sie hätten doch zwei starke Arme, da könne man doch arbeiten.
Geduld und Zeit
Wie sind diese Vorstellungen vereinbar mit der Realität in Deutschland? Mit einem hochkomplexen Arbeitsmarkt, auf dem nur der eine Chance hat, der mindestens eine Ausbildung hat? Und selbst mit Zeugnissen und Zertifikaten haben Deutsche und EU-Bürger immer Vorrang vor einem Asylsuchenden oder Flüchtling, so regelt es ein Gesetz. Aber von solchen Regeln und Bestimmungen will hier niemand etwas wissen. Auf die Fragen, wie sie sich ihre Zukunft hier vorstellen, wie das alles laufen soll, was ihre konkreten Pläne sind, haben viele nur eine Antwort: ein Handyfoto ihrer Kinder.
Ich verabschiede mich aus Lemgo und denke: Vielleicht sind unsere Erwartungen zu hoch. Es braucht Geduld und Zeit. Aber haben die Menschen in Deutschland noch Geduld?
Leicht wird das nicht
Meine Reise führt mich weiter nach Königswinter am Rhein. Von dort haben wir im Sommer 2015 schon einmal berichtet, waren live dabei, als Sozialdezernentin Heike Jüngling innerhalb von 48 Stunden eine Notunterkunft für 100 Flüchtlinge aus dem Boden stampfen musste. Eine beeindruckende, zupackende Frau. Bis heute. Wenn die Küchen in den Unterkünften dreckig sind, organisiert sie eben mal einen Putztrupp unter den Flüchtlingen. Wenn die Banken sich plötzlich weigern, das Geld am Ersten des Monats an die Flüchtlinge auszuzahlen, weil plötzlich 600 Menschen vor der Bankfiliale stehen, muss sie sich eben schnell ein neues Auszahl-System ausdenken. Was hat sich verändert in den letzten 6 Monaten, will ich von ihr wissen? "Der Berg ist viel größer geworden, die Aufgaben vielfältiger", erzählt sie mir. Es ginge nicht mehr nur um Unterbringung, sondern man müsse sich klarmachen, dass die Menschen erstmal hierbleiben. Also geht es jetzt um Arbeitsmöglichkeiten, um Kindergarten- und Schulplätze und um Wohnungen. Leicht wird das nicht.
Das erzählt auch Masud Ramazani, aus Afghanistan. Seit sechs Jahren ist er in Deutschland. Er lebt in Hamburg, er hat Arbeit, zahlt Steuern. Aber er wohnt immer noch in einer Flüchtlingsunterkunft, mit sieben anderen Männern, auf 77 Quadratmetern. Von den anderen arbeitet keiner. Seit zwei Jahren sucht er verzweifelt nach einer eigenen Bleibe. Aber auf dem umkämpften Hamburger Wohnungsmarkt ist das verdammt schwer.
Auch die Geschichte von Jawed Badakhashi zeigt, wieviele Hoffnungen sich bereits zerschlagen haben. Vor vier Monaten kam er aus Afghanistan und ist auf Amrum gestrandet. Im Winter ist die Nordseeinsel wie leergefegt, Kontakt zu Deutschen zu finden, geschweige denn Arbeit, ist schwer. Mit dem Deutsch lernen klappt es auch nicht richtig, Jawed ist Analphabet. Er hatte ganz andere Erwartungen an Deutschland. Er dachte, er könne hier einfach arbeiten und seine Familie zu Hause in Afghanistan versorgen. Stattdessen sitzt er in seiner Unterkunft im Gewerbegebiet und wartet. Aber auf was? Er hat erkannt, dass hier niemand auf ihn gewartet hat, dass es hier nicht einfach Arbeit gibt. Deshalb will er jetzt so schnell wie möglich erstmal wieder zurück in die Türkei, um dort zu arbeiten.
Ein bisschen Hoffnung
Aber ich erlebe auch Geschichten, die Mut und Hoffnung machen. Wie die von Maxino Tatasolow. Maxino floh vor einigen Jahren vor dem Bürgerkrieg im Tschad. 17 war er da und ganz allein. Heute lebt er in der Uckermark, ein dünn besiedelter Landstrich, viele sind weggezogen von hier. Aber Maxino Tatasolow hatte Glück, er traf den Milchbauern Jakob Wolters. Der suchte händeringend Lehrlinge. "Er hat mich gefragt, ob ich gerne lerne und arbeiten wolle, ich habe gesagt: 'ja, kein Problem'". Mittlerweile ist Maxino Lehrling im zweiten Jahr, er ist fleißig und zuverlässig, spielt Fußball im örtlichen Verein und ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr.
Laut einer Umfrage, die infratest dimap im Auftrag von Panorama durchgeführt hat, sagen zwei Drittel der Deutschen, dass Integration gelingen kann. Allerdings meint die Mehrzahl davon, dass man dafür die Flüchtlingszahlen begrenzen müsse. Meine Reise hat mir gezeigt: Integration kann gelingen, aber es wird dauern. Und wir alle, Flüchtlinge wie Deutsche, müssen dafür unsere Erwartungen etwas zurückschrauben.
Schlagwörter zu diesem Artikel
Migration