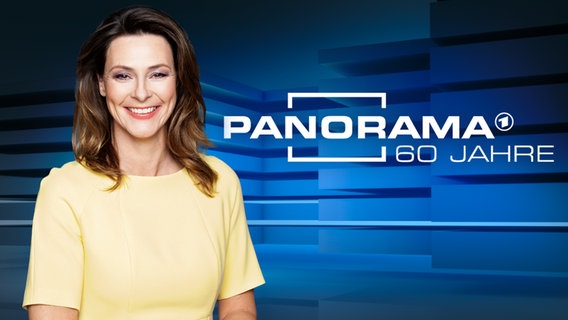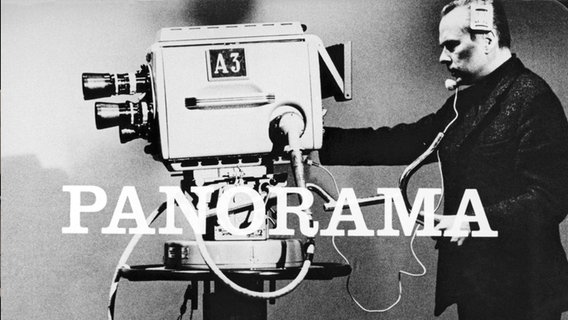"Ein großer Teil ist Erziehungsarbeit"
Reschke: Das ist doch absurd, dass eine Schule, die in einem Stadtteil liegt, der seine eigenen Herausforderungen hat, nicht irgendetwas in der Hand hat, um an sehr gute Lehrer zu kommen.
Stöck: Ja, wir sprechen das auch immer wieder an. Wir brauchen an diesen Schulen in der Tat die Besten der Besten. Und zwar in den Bereichen Teamfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, hohe fachdidaktisch und sprachliche Vermittlungskompetenz. Darüber hinaus sollten es Kolleginnen und Kollegen sein, die Lebenserfahrungen mitbringen und Persönlichkeiten sind.
Reschke: Werden denn Lehrer, die z.B. an dieser Stadtteilschule arbeiten, besser bezahlt als Lehrer, die am Gymnasium arbeiten?
Stöck: Nein. (lacht) Sie werden nach dem Besoldungsgesetz, schlechter bezahlt, sie kriegen eine Gehaltsstufe weniger als Gymnasiallehrer.
Reschke: Aber das ist doch absurd. Im Endeffekt muss man hier wahrscheinlich viel mehr pädagogische Erziehungsarbeit leisten als am Gymnasium, oder?
Stöck: Ich weiß es nicht. Ich hab nur gehört, dass die Arbeit an Gymnasien auch nicht mehr das ist, was es früher mal war, dass die Lehrer dort auch gefordert sind. Trotz alledem würde ich behaupten, pädagogisch, menschlich, also in der Lage zu sein, Frustrationstoleranzen aufzubauen und Geduld zu haben, in diesen Punkten wird man hier sicher mehr gefordert. Und das müsste auch besser honoriert werden. Wobei man auch sagen muss, Geld ist nicht alles. Ich finde ein Kollegium, das zusammenhält, das zusammenarbeitet und eine Schulleitung, die hinter einem steht, sind schon ein große Pfründe.
Reschke: Wir haben im Lehrerzimmer einige Lehrer gefragt, ob sie den Beruf nochmals wählen würden und viele sagten "Nein". Das fand ich erschreckend.
Stöck: Die sind ausgepowert. Aber dahinter verbirgt sich auch die Tatsache, dass sie mit einem anderen Bild von Schule und von Lehrersein in den Beruf gekommen sind. Ich weiß nicht, welche Kollegen das waren, ich vermute mal, Kollegen, die schon länger im Dienst sind. Ich kann das zu Teilen nachvollziehen. Das hat aber auch immer etwas mit einem selbst zu tun. Also inwieweit reflektiere ich das, was wir hier machen? Ein Beispiel: Supervision ist hier noch Neuland. Ich biete an, dass wir hier Gruppen für Kollegen bilden, um miteinander und mit einer professionellen Leitung die Arbeit zu reflektieren. Solche Supervisionen sind aber im Arbeitszeitmodell überhaupt nicht vorgesehen. Das ist an solchen Standorten aber unabdingbar, sich zu reflektieren, sich gegenseitig auch aufzufangen. Wenn das zur Pflicht werden würde, dann hätten wir mehr Möglichkeiten und die Kollegen auch längerfristig mehr Spaß an ihrem Job.
Reschke: Wie ist das an Ihrer Schule - aus welchen Elternhäusern kommen die Kinder?
Stöck: Wir haben alle Varianten an Erziehung oder Nicht-Erziehung hier vor Ort. Wir haben dieses Paket an Schülern und Schülerinnen, die keine Resonanz zuhause haben. Da kümmert sich keiner drum. Das machen wir. Es gibt den Mittelbau, wo das normal läuft, die Eltern uns unterstützen und es gibt auch diesen Teil, der total überbehütet ist, wo wir eher auch zurückdrängen und sagen, "ich will mit dem Kind arbeiten, nicht nur mit Ihnen". All dies haben wir hier und auf diese unterschiedlichsten Formen von Kindheit, die die Kinder mit in die Schule bringen, müssen sich unsere Lehrer einstellen. Es ist nicht der eine Blick auf die Kindheit, das ist vorbei.
Reschke: Das war früher anders?
Stöck: Ja, zu meiner Zeit, da gab es gewissermaßen einen gesellschaftlichen Erziehungsstil, der galt für alle. Und heute wuchert die Individualisierung der Erziehungsstile. Das ist unglaublich. Es gibt viele, die sagen, das ist große Klasse, dass wir so individuell erziehen und uns um unsere Kinder kümmern oder auch nicht kümmern. Das hat aber die Konsequenz, dass die Institution Schule einer ziemlichen Herausforderung ausgesetzt ist.
Reschke: Was muss denn Schule heute leisten, was im Prinzip gar nichts mit dem klassischen Mathe- oder Deutschunterricht zu tun hat?
Stöck: Wir bieten Unterstützung in Sachen Erziehung, Berufsorientierung, Sucht- und Gewaltprävention, Freizeitgestaltung,wie gehe ich als Jugendlicher eigentlich mit Schulden um. Wir organisieren Nachhilfe, Förderung jeder Art. Wir knüpfen Kontakte für Schüler, wenn es um Therapieplätze geht. Wir arbeiten mit Einrichtungen zusammen für Kinder, die Probleme zuhause haben. Wir bieten Unterstützung für Kinder, die von Zuhause flüchten. Dies alles zusammen mit unseren Partnern im "Stübi-Netzwerk". Das kann Schule nicht allein leisten. Dann kompensieren wir Erziehungsdefizite. Wie frühstücken wir gemeinsam, ohne dass die Brötchen fliegen. Was heißt eigentlich Messer und Gabel. Das ist jetzt etwas übertrieben, stimmt aber im Kern. Pädagogische Arbeit umfasst in den ersten Jahrgängen oft mehr Zeit als Unterricht.
Reschke: Wie müsste sich Schule verändern, um all das aufzufangen?
Stöck: Man muss jeden Standort für sich betrachten. Es gibt nicht DIE eine Stadtteilschule. Schule verändert sich im vorgegebenen Rahmen ständig. Ich möchte, dass das Prinzip Kopf, Herz und Hand wirklich ernstgenommen und gleichberechtigt behandelt wird. Ich möchte für meinen Standort neben der Sitzschule Formen und Varianten des Produktionsschulgedankens entwickeln. Mehr Arbeit für Produktionen in Werkstätten, Studios und Ateliers. Und vor allem das Aufbrechen der Stundentaktung, mehr Prozesse. Die Kinder müssen verstehen und letztlich lesen, rechnen, schreiben können.
- Teil 1: Schule als Wissensvermittler?
- Teil 2: "Wir brauchen an diesen Schulen die Besten der Besten"