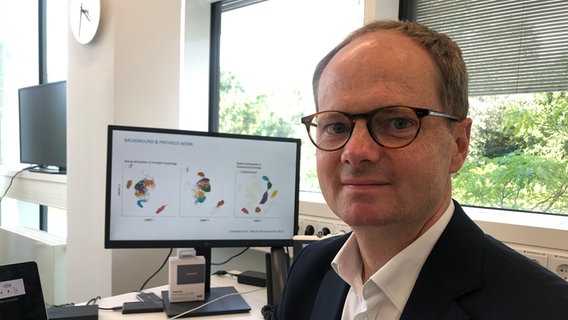Forscher der Uni Lübeck wollen Geschlecht neu definieren
Männlich, weiblich, fertig. Dass es nicht so einfach ist und es viele Varianten von Geschlecht gibt, weiß die Medizin schon länger. Bisher wurde es aber nur in einzelnen Fachbereichen untersucht. Das ändert sich jetzt.
Wie Geschlecht in der Forschung behandelt wird, hat eine größere Auswirkung auf jeden einzelnen von uns als man vielleicht zuerst denkt. In der Medizin wurde beispielsweise jahrzehntelang nur an männlichen Körpern geforscht und die Ergebnisse eins zu eins auf Frauen übertragen. Dabei gibt es große Unterschiede, im Gehirn und anderen Organen - in jeder einzelnen Zelle.
Wie unterscheiden sich Zellen ja nach Geschlecht?
Bei ihrem Forschungsprojekt im Institut für Humangenetik untersuchen Malte Spielmann und sein Team die Zusammensetzung einzelner Zellen, erst mal mit Proben von Mäuseorganen. Sie wollen herausfinden, wie sich die Zellen je nach Geschlecht unterscheiden. "In den Immunzellen des Gehirns findet man bei männlichen Mäusen bestimmte Zelltypen, die bei weiblichen anders sind. Und wenn diese Mäuse in die Wechseljahre kommen, dann sieht man wieder ganz andere Zelltypen", erklärt Spielmann. Im nächsten Forschungsschritt wollen sie das auch an menschlichen Zellen untersuchen. Ihre These: Auch bei Menschen sehen Zellen unterschiedlich aus, bei Männern anders als Frauen oder Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. Zukünftig könnte das auch bei medizinischen Behandlungen entscheidend sein.
"Geschlecht geht jeden an"
Spielmanns Projekt ist eines von insgesamt 17 Einzelprojekten zum Thema "Sexdiversity". Seit einem Monat forschen rund 50 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen von Biologie über Medizin bis zu Philosophie gemeinsam über die Vielfalt des Geschlechts. Ihr Ziel: Sie wollen Geschlecht neu definieren, Wissenslücken schließen - zum Wohle aller.
"Letztendlich geht Geschlecht jeden von uns an." Olaf Hiort, Sprecher des Sonderforschungsbereichs
Die Forschung an den Mäuseorganen von Spielmann ist Grundlagenforschung für zukünftige medizinische Behandlungen: "Bei jeder Stellenausschreibung können Sie sich mittlerweile als männlich, weiblich oder divers bewerben, aber wenn Sie ins Krankenhaus kommen, werden Sie in zwei Kategorien eingeteilt - die vielleicht gar nicht zutreffen: Ich könnte zum Beispiel ein etwas weibliches Fettgewebe haben, mein Herz könnte dafür eher männlich sein. Daher wollen wir schauen, ob wir bessere Therapien entwickeln können, im Sinne einer personalisierten Medizin."
Gemeinsam besser forschen und verstehen

Andere Einzelprojekte beschäftigen sich mit dem Wissen über Geschlecht an sich. So untersuchen zum Beispiel die Kulturwissenschaftlerin Birgit Stammberger und ihr Team, wie in der biomedizinische Forschung Geschlecht definiert wird. Eine außergewöhnliche Zusammenarbeit von Kulturwissenschaften und Molekularbiologie, die laut Stammberger nur an der Uni Lübeck so möglich sei.
"Ich glaube, dass wir die große Kluft zwischen den Natur- und den Geisteswissenschaften hier überwinden. " Birgit Stammberger, Kulturwissenschaftlerin
"Bridging the gap" sei eine Form von Forschung, in der es darum gehe den anderen Disziplinen und deren Methoden mit einer großer Offenheit zu begegnen. Auch für Spielmann ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen ein großer Vorteil bei der Forschung zum Thema "Sexdiversity": "Ich hätte mich vorher gar nicht richtig getraut auf diese Geschlechtsunterschiede, die wir messen können, hinzuweisen, weil ich sie auch nicht vollständig erklären kann", so der Humangenetiker. "Und dabei helfen mir zum Beispiel Medizinhistoriker oder Sozialwissenschaftler, um das einzuordnen und meine eigenen Ergebnisse besser zu verstehen."
Drei Jahre Förderung für "Sexdiversity"
Bis 2027 wird der Sonderforschungsbereich "Sexdiversity" noch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit rund 10 Millionen Euro gefördert. Bis dahin wollen die Forschenden der Unis Lübeck und Kiel zusammen mit Expertinnen und Experten aus Berlin, Flensburg, Magdeburg, München und Hannover bessere Voraussetzungen für medizinische Behandlungen schaffen, ethische und rechtliche Grundlagen klären. Kurz: Geschlechtliche Vielfalt wissenschaftlich prüfen.
Schlagwörter zu diesem Artikel
Medizinische Forschung