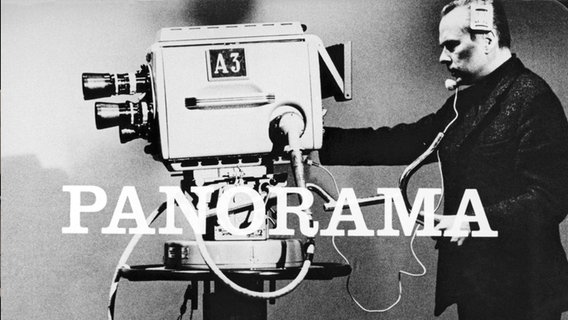Verstrahlte Soldaten - Der Kampf gegen die Bürokratie
Wer Soldat wird, lebt natürlich risikoreicher als Bürger in Zivil. Manöver, unter Umständen gefährliche Auslandseinsätze, im schlechtesten Fall ein Krieg. Dienen heißt auch dienen unter Lebensgefahr, das weiß jeder Soldat. Was jetzt aber so einige Ältere von ihnen beschäftigt, ist ein auch für Soldaten vermeidbares Risiko: Röntgenstrahlung. Hunderte vermuten, durch ihren Einsatz an Radarsystemen Krebs bekommen zu haben. In der Technik-Euphorie der vergangenen Jahrzehnte hat man offensichtlich übersehen oder auch nicht wahrhaben sollen, dass Strahlen auch tödlich sein können. Folgerichtig hat man diese Soldaten, meistens Techniker, davon nicht oder nur unzureichend gewarnt. Die Bundeswehr wollte uns dazu kein Interview geben, aber sie hat schriftlich dazu Stellung bezogen. Sie habe, so steht da, stets dafür Sorge getragen, dass - Zitat - "die jeweils gültigen Grenzwerte für bekannte Strahlungsarten eingehalten und möglichst unterschritten wurden." Das sehen einige Soldaten ganz anders.
Die meisten sind gestorben, ohne zu wissen warum, zum Beispiel Claus Becht. Er wurde nur 40 Jahre alt. Claus Becht gehörte 1958 zu den ersten Soldaten der Bundeswehr. In Kaufbeuren wurde er zum Radarbeobachter und Techniker ausgebildet. Was er nicht ahnte: In seinem Radarwagen saß er jahrelang im Einflussbereich krebserregender Röntgenstrahlen. Seine Frau ist sich heute sicher, dass ihr Mann den Krebs wegen dieser Röntgenstrahlung bekam. Was Maria Becht besonders verbittert: Die Soldaten hätten über die Gefahr informiert werden können. Ein Messbericht von 1958 hat die Strahlenbelastung eines Radartechnikers in Kaufbeuren klar beschrieben: "So ist es als besonders erschwerend festzustellen, dass gerade seine empfindlichsten Organe, die Keimdrüsen, mit der dreifachen Dosis bestrahlt werden."
Maria Brecht, die Ehefrau berichtet traurig: "Das ist eine Form von Menschenverachtung, möchte ich sagen, wenn man weiß, dass eine Gefahr besteht, dass man den Betroffenen nicht auf die Gefahr hinweist und keine Schutzmaßnahmen trifft. Ich finde es sehr traurig, dass diese jungen Menschen mit 18 bereits ihr Todesurteil unterschrieben haben."
Die Radartechniker in Kaufbeuren wurden über die Gefahren nicht aufgeklärt, auch Peter Rasch nicht, dabei war er sogar Ausbilder. Über die in dem Messbericht geforderten Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel die Ausgabe von Bleihandschuhen wurde er nie informiert: "Bei uns sind nie Schutzmaßnahmen angeführt worden, wir sind nie belehrt worden, wir haben nie Strahlendosimeter getragen."
Peter Rasch litt schon in Kaufbeuren an Sehstörungen und Nervenlähmungen. 1994 dann die Diagnose: Krebs. Seine Ansprüche auf Entschädigung hat er bis heute nicht endgültig durchsetzen können: "Ich bin besonders darüber wütend, dass man alle diese tragischen Schicksale hätte verhindern können, indem man bekannte Schutzvorschriften einfach angewandt hätte. Es hätte viel Leid erspart werden können, Männer wären noch da in ihren Familien, und wahrscheinlich hätte ich auch meinen Krebs überhaupt nicht erst bekommen."
Übernahme einer Radarstation 1961. Der Beginn eines der traurigsten Kapitel in der Geschichte der Bundeswehr. Die jungen Männer wussten nicht, wie gefährlich die Arbeit an den Geräten wirklich ist. Dabei lagen nachweislich Erkenntnisse über die Gefahren im Verteidigungsministerium vor. Die aber wurden nur unzureichend oder gar nicht an die Truppe weitergegeben. So war das Schicksal der deutschen Radartechniker früh besiegelt. Auch das von Hans-Jürgen Runge. Die Bundeswehr bestritt jahrelang, dass er bei der Reparatur der Radaranlagen von Kampfflugzeugen in unmittelbarer Nähe der Geräte gearbeitet hat. Zwei Vorgesetzte bestätigten seine Aussagen, ein Gericht gab ihm Recht. Trotzdem muss Runge noch immer um eine Anerkennung als Wehrdienstbeschädigter kämpfen:
"Ich bin sehr enttäuscht, und zwar deshalb enttäuscht, weil ich zumindest erwartet hätte, dass man seriös behandelt worden wäre, fair vor allen Dingen. Denn wenn schon, in meinem Fall speziell, all das an Dokumenten, an Material, an Aussagen, Vorsätzen auf dem Tisch liegt, dass dennoch dieser Weg eingeschlagen wird, um künstlich das zu verzögern, zu vertuschen, um Zeit zu gewinnen, halte ich nach wie vor für skandalös."
Mitte der siebziger Jahre wurde bei der Radaranlage der Fregatte Emden weit überhöhte Röntgenstrahlung gemessen. Aus strahlenschutzrechtlichen Gründen hätten die baugleichen Anlagen von 22 Schiffen sofort stillgelegt werden müssen. Dies geschah nicht. Mechaniker waren dem 60fachen der zulässigen Röntgendosis ausgesetzt. Zitat aus einem vertraulichen Messprotokoll: "Die Messungen haben ergeben, dass vom Bedienungs- und Instandsetzungspersonal Strahlendosen aufgenommen werden können, die ein Vielfaches der gemäß Röntgenverordnung zulässigen Werte erreichen."
Ulrich Häntzschel war Radartechniker beim Luftabwehrsystem Hawk. Er hat mehrfach am eigenen Leib erfahren, wie bei Manövern Sicherheitsbestimmungen gebrochen wurden, zum Beispiel als ein Offizier bei einer Luftverteidigungsübung möglichst gut abschneiden wollte und dafür in Kauf nahm, dass die ihm unterstellten Techniker vom Radarstrahl erfasst wurden.
Häntzschel erinnert sich: "Bei Reparaturarbeiten an einem Radargerät wurde ich von einem Beleuchtungs-Radargerät, was von der Feuerleitzentrale von einem Offizier gesteuert wurde, angestrahlt. Als ich dies bemerkte, habe ich mich in der Feuerleitzentrale gemeldet, und der zuständige Offizier sagte dann: Ich kann keine Rücksicht nehmen, ich bin am Kämpfen, wir haben Krieg. Ende."
Häntzschels direkter Vorgesetzter, Winfried Hermann, wurde Zeuge dieses Manövervorfalls: "In diesem Falle war es dann wirklich so - und das kann ich eindeutig bestätigen -, dass der taktische Offizier gesagt hat: Ich kann darauf keine Rücksicht nehmen, wir sind im Krieg. Das hat er wortwörtlich gesagt. Auf meine Bemerkung hin, wir sind nicht im Krieg, sondern er soll gefälligst aufpassen, denn letztendlich werden ja meine Leute angestrahlt bzw. sind einer Strahlenexposition ausgesetzt. Und dann hat er nur gelacht und hat gesagt, er kann darauf keine Rücksicht nehmen, und hat das Gespräch unterbrochen."
Dem verantwortlichen Offizier passierte trotz eines Wehrdisziplinarverfahrens nichts. Die Radartechniker vom Flugabwehrraketen-Bataillon in Lenggries aber zahlten offenbar einen hohen Preis. Winfried Hermann bekam Prostatakrebs, wurde inzwischen dreimal operiert.
Ulrich Häntzschel erkrankte an Hodenkrebs. Nach Ablehnung seines Antrags auf Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung klagte er gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das Sozialgericht München gab ihn 1999 Recht. Der Bund ging in Berufung. Deshalb erhielt Häntzschel bis heute keine Anerkennung.
Häntzschel klingt verbittert: "Ich habe einen Eid auf die Bundesrepublik Deutschland geleistet, bin meiner Verpflichtung nachgekommen und habe den Anspruch von meinem ehemaligen Dienstherrn auf Fürsorgepflicht, die von der Bundeswehr bis jetzt in keiner Weise wahrgenommen wurde - es wurde verschleppt, verschleiert und verzögert. Und im Endeffekt setzt die Bundeswehr auf die biologische Lösung - irgendwann versterben die Betroffenen.
Bei einem anderen Kameraden aus der gleichen Einheit ist die biologische Lösung schon eingetreten. Edeltraud Jost muss seit zwei Jahren allein für ihre drei Kinder sorgen. Ihr Mann Götz starb im Alter von 41 Jahren an einem besonders aggressiven Unterleibskrebs. Den Antrag auf Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung hat die Bundeswehr noch vor einem halben Jahr abgelehnt.
Edeltraud Jost: "Es macht sich jeder zu leicht. Ich bin der Meinung, die wollen das aussitzen und hoffen, je länger das dauert, desto weniger haben die Mut überhaupt irgendwie zu klagen, Anträge zu stellen, und je mehr sterben, desto einfacher ist es. Und die Hinterbliebenen haben meist auch nicht mehr die Kraft, irgendwas zu tun."
Weiterführende Informationen zu diesem Thema:
Infoline der Bundeswehr zu Radar-Verstrahlung:
Tel.: 0228 - 94 25 00 0
Interessengemeinschaft betroffener Soldaten:
Email: PRasch@surfeu.de